Über den Tod
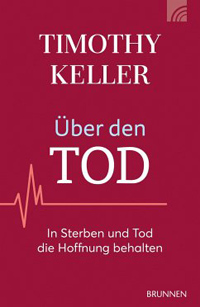 Alle Verharmlosungen und gut gemeinten Sprüche wie „Der Tod gehört zum Leben“ helfen nicht: Der Tod bleibt „die große Zäsur“, die „große Trennung“, die „große Beleidigung“, wie es der amerikanische Pastor und Autor Timothy Keller in seinem jüngsten Buch formuliert.
Alle Verharmlosungen und gut gemeinten Sprüche wie „Der Tod gehört zum Leben“ helfen nicht: Der Tod bleibt „die große Zäsur“, die „große Trennung“, die „große Beleidigung“, wie es der amerikanische Pastor und Autor Timothy Keller in seinem jüngsten Buch formuliert.
Anstatt in Angst vor dem Tod zu leben oder ihn zu verdrängen, sollten wir ihn als „geistliches Riechsalz“ betrachten, schreibt Keller, „das uns aus unserem falschen Glauben aufweckt, dass unser Leben ewig so weitergehen würde“. Gegen die Angst hilft nur einer: der „Vorkämpfer“ Jesus Christus. Das versteht Keller, in werbender, wärmender, tröstlicher, glaubwürdiger Art nahezubringen. Jesus Christus hat am Kreuz den Tod besiegt.
Nein, der Tod ist nicht einfach ein Teil des natürlichen Kreislaufes. Würden unser Erschrecken und unsere Trauer dann dazu passen? „Der Tod war so nicht gedacht. Er ist unnormal. Er ist kein Freund, er ist nicht richtig. Er gehört nicht wirklich zum Kreislauf des Lebens; er ist das Ende des Lebens“, schreibt Keller und weiter: „Also trauern Sie. Weinen Sie. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir weinen sollen, sondern, dass wir mit den Weinenden weinen sollen (Römer 12, 15). Es gibt eine Menge zu weinen.“ Aber: mit Hoffnung trauern! Und dafür haben wir Christen allen Grund. Diese biblisch begründete Hoffnung macht Keller in seinem Buch groß.
Kurz nachdem das Buch erschienen war, erhielt Timothy Keller die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs; am 19. Mai 2023 verstarb er. Die deutsche Ausgabe enthält als drittes Kapitel einen Artikel, den Keller angesichts der Aussicht auf seinen eigenen nahen Tod geschrieben hat. Ein berührendes Zeugnis des Glaubens, das wirklich trösten kann.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Timothy Keller:
Über den Tod. In Sterben und Tod die Hoffnung behalten
Brunnen Verlag 2023, 96 Seiten, 12,00 Euro
Heiteres aus dem Gemeindeleben
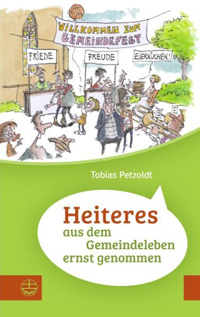 Ja, doch, das Gemeindeleben hat auch Heiteres zu bieten! Man muss bestimmte kirchliche und pastorale Gewohnheiten nur etwas zuspitzen und so liebevoll karikieren, wie das Tobias Petzoldt kann, dann ist Kirche durchaus erheiternd. Wer erkennt sich nicht in dem Familiengottesdienst, in dem man mit den Armen eine Sonne malt und einen Hut, hochspringt und aufstampft, in dem ein Meer aus Handys filmt, was die Kinder vorne spielen (was man von hinten nur erahnt). Auch das „einzigartig stille Örtchen“, das Sakristei genannt wird, kommt einem irgendwie bekannt vor. „Zwischen einer kaputten Holzkrippe vom vorletzten Krippenspiel, halb vollen Abendmahlsweinflaschen, einer Kerzenstumpensammlung und einem Kruzifix mit schiefem Heiland, dran hängen Fotos von Jubel-, goldenen und sonstigen Konfirmanden mit seltsamen Brillen und einer Mode, die gewiss einmal wiederkommen wird.“
Ja, doch, das Gemeindeleben hat auch Heiteres zu bieten! Man muss bestimmte kirchliche und pastorale Gewohnheiten nur etwas zuspitzen und so liebevoll karikieren, wie das Tobias Petzoldt kann, dann ist Kirche durchaus erheiternd. Wer erkennt sich nicht in dem Familiengottesdienst, in dem man mit den Armen eine Sonne malt und einen Hut, hochspringt und aufstampft, in dem ein Meer aus Handys filmt, was die Kinder vorne spielen (was man von hinten nur erahnt). Auch das „einzigartig stille Örtchen“, das Sakristei genannt wird, kommt einem irgendwie bekannt vor. „Zwischen einer kaputten Holzkrippe vom vorletzten Krippenspiel, halb vollen Abendmahlsweinflaschen, einer Kerzenstumpensammlung und einem Kruzifix mit schiefem Heiland, dran hängen Fotos von Jubel-, goldenen und sonstigen Konfirmanden mit seltsamen Brillen und einer Mode, die gewiss einmal wiederkommen wird.“
Natürlich fehlen auch die Vorstandssitzung nicht und das Gemeindefest und das „Meisterstück zeitgenössischer Gegenwartskunst“, der Schaukasten, und die Abkündigungen, die doch eigentlich etwas ankündigen …
Tobias Petzoldt, Diakon, Kleinkünstler und Autor, hat Beiträge aus seinen Kabarettprogrammen und geistliche Gedanken zusammengetragen. „Heiteres aus dem Gemeindeleben ernst genommen“: der Titel passt. Die kurzen Texte lassen die Liebe zur Kirche erkennen und sind gleichzeitig distanziert genug, um das Schrullige und Sonderbare einer Kirchengemeinde zu erkennen. Sie sind nachdenklich und witzig, tiefsinnig und vergnüglich – und gut geeignet, um zum Beispiel am Gemeindefest (oder einer anderen Gelegenheit aus der „gestalteten Gemeindemitte“) vorgelesen zu werden.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Tobias Petzoldt:
Heiteres aus dem Gemeindeleben ernst genommen
Evangelische Verlagsanstalt 2022, 136 Seiten, 12,00 Euro
Ein Sonett für die Müllerin
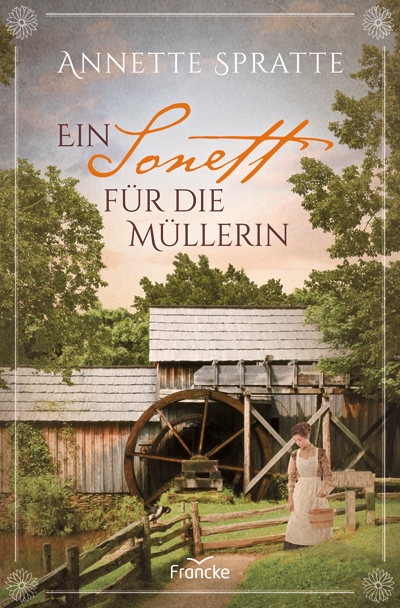 Die Autorin Annette Spratte findet ihre Geschichten in der Umgebung, in der sie lebt, im Westerwald. Und sie hat auch ihren unverwechselbaren Ton gefunden, in dem sie erzählt. Die Geschichten entwickeln sehr schnell einen Sog, der einen hineinzieht – diesmal in die Welt einer Mühle in Altenkirchen in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die 30-jährige Sophie betreibt dort mit ihrem Vater die Mühle und hofft, dass das Leben nach dem Krieg wieder besser wird und dass ihr Mann, der sich freiwillig als Söldner verdingt hatte, endlich wieder heimkommt. Als im Mühlengraben die Leiche eines Soldaten entdeckt wird, passieren seltsame Dinge auf dem Hof, und die Geschichte nimmt an Tempo und Spannung zu. Der Autorin gelingt es durch genaue Recherche nicht nur, das Mühlenhandwerk farbig und anschaulich zu schildern, sie ist auch eine Meisterin in der Figurengestaltung. Sophie, ihre Freundin Elßgen, die alte, abergläubische Magd Martha, Konrad, der Lehrling des Müllers – sie werden lebendig und gewinnen schnell die Sympathie der Leserin. Als Sophies Mann nach Hause kommt, zieht in die Mühle nicht die erhoffte Ruhe ein, im Gegenteil. Dietrich entwickelt sich zum Tyrannen, er schlägt Sophie und vergewaltigt sie. Dass es Annette Spratte gelingt, auch dieses Thema so subtil aufzunehmen, mit der damit verbundenen Erniedrigung, der Scham und dem falschen Pflichtgefühl, zeugt von großem Können und Sprachbewusstsein.
Die Autorin Annette Spratte findet ihre Geschichten in der Umgebung, in der sie lebt, im Westerwald. Und sie hat auch ihren unverwechselbaren Ton gefunden, in dem sie erzählt. Die Geschichten entwickeln sehr schnell einen Sog, der einen hineinzieht – diesmal in die Welt einer Mühle in Altenkirchen in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die 30-jährige Sophie betreibt dort mit ihrem Vater die Mühle und hofft, dass das Leben nach dem Krieg wieder besser wird und dass ihr Mann, der sich freiwillig als Söldner verdingt hatte, endlich wieder heimkommt. Als im Mühlengraben die Leiche eines Soldaten entdeckt wird, passieren seltsame Dinge auf dem Hof, und die Geschichte nimmt an Tempo und Spannung zu. Der Autorin gelingt es durch genaue Recherche nicht nur, das Mühlenhandwerk farbig und anschaulich zu schildern, sie ist auch eine Meisterin in der Figurengestaltung. Sophie, ihre Freundin Elßgen, die alte, abergläubische Magd Martha, Konrad, der Lehrling des Müllers – sie werden lebendig und gewinnen schnell die Sympathie der Leserin. Als Sophies Mann nach Hause kommt, zieht in die Mühle nicht die erhoffte Ruhe ein, im Gegenteil. Dietrich entwickelt sich zum Tyrannen, er schlägt Sophie und vergewaltigt sie. Dass es Annette Spratte gelingt, auch dieses Thema so subtil aufzunehmen, mit der damit verbundenen Erniedrigung, der Scham und dem falschen Pflichtgefühl, zeugt von großem Können und Sprachbewusstsein.
Dass in den Büchern von Annette Spratte der Glaube immer auch eine wichtige Rolle spielt, ist nicht nur der Zeit, in der ihre Geschichten spielen, geschuldet. So behutsam und warmherzig, wie sie ihre Figuren schildert, gehören Fragen nach Gott und seiner Hilfe einfach dazu – weil sie menschlich
sind.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Annette Spratte:
Ein Sonett für die Müllerin
Francke Verlag 2022, 427 Seiten, 15,95 Euro
Das Medaillon
 Das Medaillon, das dem Buch den Titel gab, hat Rosa von ihrem Mann Itzhak zur Hochzeit bekommen. Als ihre Tochter Ania geboren wird, ist ihre Welt schon lange bedroht. 1938 ist die jüdische Familie gezwungen, ins Warschauer Ghetto zu ziehen, aber auch dort sind sie von Hunger, Zerstörung und Verfolgung bedroht. Als Itzhak sich nach Litauen durchschlägt, um seine Eltern zu suchen, spitzt sich die Situation so zu, dass Rosa ihre Tochter einer Fremden abgibt, um ihrem Kind das Leben zu retten. Sie teilt das Medaillon in zwei Teile und gibt die eine Hälfte ihrer Tochter mit.
Das Medaillon, das dem Buch den Titel gab, hat Rosa von ihrem Mann Itzhak zur Hochzeit bekommen. Als ihre Tochter Ania geboren wird, ist ihre Welt schon lange bedroht. 1938 ist die jüdische Familie gezwungen, ins Warschauer Ghetto zu ziehen, aber auch dort sind sie von Hunger, Zerstörung und Verfolgung bedroht. Als Itzhak sich nach Litauen durchschlägt, um seine Eltern zu suchen, spitzt sich die Situation so zu, dass Rosa ihre Tochter einer Fremden abgibt, um ihrem Kind das Leben zu retten. Sie teilt das Medaillon in zwei Teile und gibt die eine Hälfte ihrer Tochter mit.
Die Autorin Cathy Gohlke hat wahre Begebenheiten aus dem Zweiten Weltkrieg in eine fiktive Geschichte verwoben. Dass Mütter sich entscheiden mussten, ihre Kinder wegzugeben, weil sie sie sonst mit in den Tod genommen hätten, ist belegt. Genauso wie der Fluchttunnel, den jüdische Häftlinge im litauischen Ponary gruben, als sie gezwungen waren, die Leichen der Menschen, die die SS erschossen und in Massengräber geworfen hatte, auszugraben und zu verbrennen. Die Nazis wollten damit verhindern, dass die näherrückenden Russen die Gräueltaten entdecken könnten. Cathy Gohlke fand Interviews, in denen von einem Mann erzählt wurde, der bei diesem Ausgraben der Leichen auf seine Angehörigen gestoßen sein soll und dabei seine Frau anhand eines Medaillons identifiziert habe, das er ihr am Hochzeitstag geschenkt hatte.
Der Autorin gelingt es, diese schier unglaublichen Geschehnisse mit vielen Details und einer einfühlsamen, großartigen Figurengestaltung in eine Geschichte zu gießen, die einen beim Lesen von Anfang bis zum Schluss fesselt.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Cathy Gohlke:
Das Medaillon
SCM Hänssler Verlag 2022, 445 Seiten, 23,00 Euro
Seit ich tot bin, kann ich damit leben
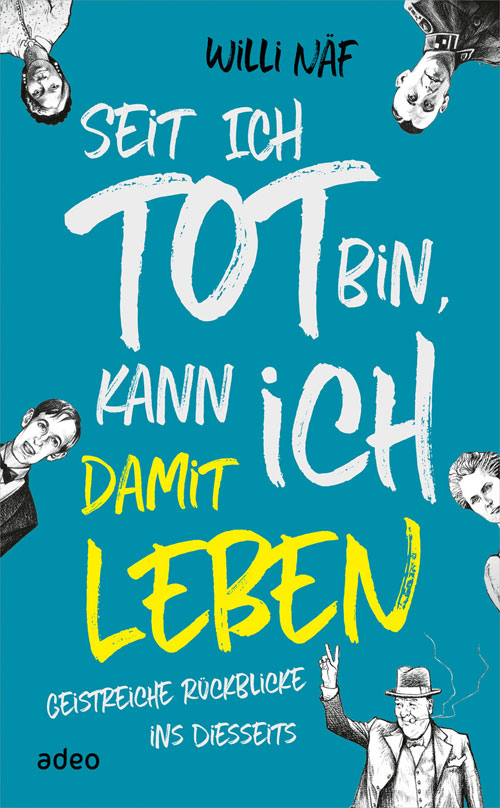 Interviews mit Verstorbenen: das ist zwar keine ganz neue Idee, die der Autor Willi Näf zur Grundlage seines Buches macht, aber so gekonnt, wie er sie umsetzt, werden sie zur außergewöhnlichen Leseerfahrung, inspirierend und unterhaltsam dazu.
Interviews mit Verstorbenen: das ist zwar keine ganz neue Idee, die der Autor Willi Näf zur Grundlage seines Buches macht, aber so gekonnt, wie er sie umsetzt, werden sie zur außergewöhnlichen Leseerfahrung, inspirierend und unterhaltsam dazu.
Zehn Persönlichkeiten aus der Geschichte lernt man kennen – zunächst in Kurzbiografien, die für sich schon dokumentieren, wie sorgfältig Willi Näf die Geschichten seiner „Interviewpartner“ recherchiert hat. In den nachfolgenden Gesprächen mit den Toten kann er dann „persönlicher“ werden, die Lebensgeschichten aus anderen Blickwinkeln beleuchten und „nachfragen“.
Da ist zum Beispiel Alice von Battenberg, die Schwiegermutter der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth II. Als gehörlose Prinzessin 1885 geboren, ist ihr Leben fast zu turbulent, um es auf wenigen Seiten zu skizzieren. Willi Näf gelingt es trotzdem, und so erfährt man die unglaublichsten Zusammenhänge in der Geschichte des deutsch-englischen Adels und der verrückten, kettenrauchenden Ordensgründerin.
Im gleichen „Dunstfeld“ wie Alice von Battenberg lebte Sarah Forbes Bonetta. Als fünfjähriges afrikanisches Mädchen wird sie davor bewahrt, als „rituelles Opfer“ getötet zu werden und landet – im fernen England auf Schloss Windsor und wächst als Queen Victorias „little negro princess“ auf. Der fiktive Schlagabtausch, zum Beispiel über kulturelle Aneignung, den sich der Autor mit der toten Sarah liefert, ist große Sprach- und Denkkunst.
Besonders interessant sind auch die Geschichten von Mary Ann Graves, eine der wenigen Überlebenden der amerikanischen Auswanderer-Tragödie der Donner-Party; oder die von Elisabeth Christ Trump, der Großmutter des späteren US-Präsidenten; die von James Bedford, dem Mann, der sich als erster tiefgefrieren ließ; oder die von Katharina Morel, die ihrem Mann in den Krieg nachzog und als Marketenderin Napoleons Russland-Feldzug überlebte.
Weniger gelungen ist das Gespräch mit Charles A. Lindbergh Junior, der mit zwei Jahren entführt und umgebracht wurde, und jenes mit der Gottesmutter Maria, das ziemlich bemüht daherkommt.
Willi Näf ist Journalist und Satiriker. In den fiktiven Gesprächen weiß er das Handwerk des Interviewens mit dem Humor und manchmal dem Sarkasmus der Satire perfekt zu kombinieren. Klar, die Interviews sind frei erfunden, aber eben doch nah dran an den Leben der Porträtierten. Der Interviewer erfährt zusätzliche Details ihres Lebens – na ja, er legt sie den Befragten in den Mund. Sie korrigieren ihn, wo sie sich falsch dargestellt sehen und kommentieren auch mal das Zeitgeschehen. Großes und lehrreiches Lesevergnügen!
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Willi Näf:
Seit ich tot bin, kann ich damit leben
Adeo Verlag 2022, 288 Seiten, 22,00 Euro
Der Glaube, die Kirche und ich
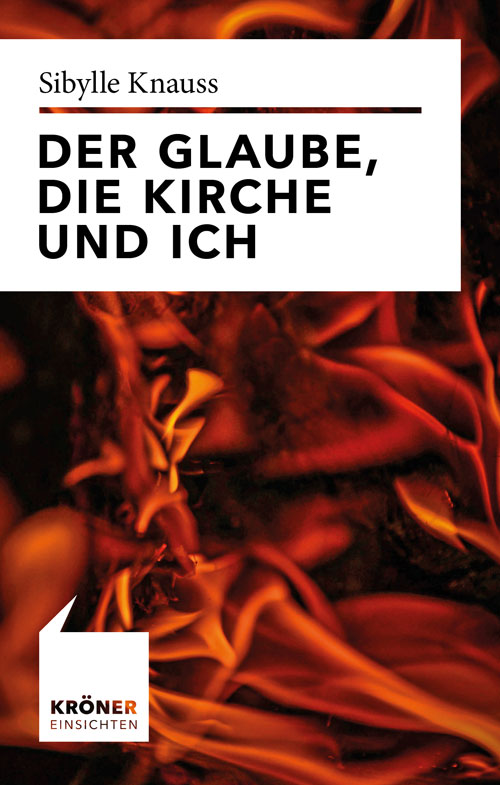 Aus der Kirche auszutreten scheint einfach: beim Meldeamt ein Formular ausfüllen und eine Gebühr zahlen – das war‘s. War‘s das? Für die Schriftstellerin Sibylle Knauss jedenfalls nicht. Ihren Austritt – sie ist damals Anfang 50 – scheint niemand in der Kirche zu bemerken oder gar zu bedauern. „So umstandslos entließ man mich aus der heiligen christlichen Kirche, wie es im Apostolischen Glaubensbekenntnis heißt? Der Kirche, in der ich mein Heil, Vergebung meiner Sünden und das ewige Leben finden sollte? Und kein Entsetzen darüber, dass ich all das von mir wies? Zumindest Bekümmerung? Oder wenigstens Bedauern. Eine Geste des Abschieds. …“
Aus der Kirche auszutreten scheint einfach: beim Meldeamt ein Formular ausfüllen und eine Gebühr zahlen – das war‘s. War‘s das? Für die Schriftstellerin Sibylle Knauss jedenfalls nicht. Ihren Austritt – sie ist damals Anfang 50 – scheint niemand in der Kirche zu bemerken oder gar zu bedauern. „So umstandslos entließ man mich aus der heiligen christlichen Kirche, wie es im Apostolischen Glaubensbekenntnis heißt? Der Kirche, in der ich mein Heil, Vergebung meiner Sünden und das ewige Leben finden sollte? Und kein Entsetzen darüber, dass ich all das von mir wies? Zumindest Bekümmerung? Oder wenigstens Bedauern. Eine Geste des Abschieds. …“
Sie selbst aber merkt, dass dieser Schritt „nicht zu ihr passt“, dass eine Balance dadurch gestört wurde. Nach einigen Jahren tritt sie wieder ein. Und erlebt von Seiten der Kirche dieselbe Gleichgültigkeit wie bei ihrem Austritt.
Die heute 78jährige Autorin ist eine scharfe Beobachterin. Theologisch gebildet, macht sie sich in ihrem sehr persönlichen Buch auf die Suche nach Spuren göttlicher Gegenwart, in ihrem Leben, im Gottesdienst, in der Kirche. Es ist die Sehnsucht spürbar nach leidenschaftlichem Glauben, nach entschiedener Frömmigkeit. Und gleichzeitig doch immer eine kühle Distanz dazu. „Gebet und Gotteslob halte ich für unentbehrlich, um eine Art existenzieller Balance für mich zu erhalten“ schreibt Knauss, „fühle mich aber in der säkularen Gesellschaft, die mich umgibt, alleingelassen damit.“
Sibylle Knauss hinterfragt, sucht, versteht und zweifelt. Sie erzählt (sich) die Leidensgeschichte Jesu und (man) wird von ihr neu gefangengenommen. Sie feiert Ostern, das jeder Erwartbarkeit spottet, gegen die Natur ist, „wunderbar, unerklärlich und großartig“. Sie ärgert sich über Gottesdienste, in denen Klima- und Weltrettung die Botschaft von der ewigen Seligkeit ersetzt haben. Sie fragt sich, ob die junge Pfarrerin wohl an ihrem Grab „die Kühnheit besitzen wird, davon zu sprechen, dass ich zu Gott heimgekehrt bin? Zum ewigen Leben erwacht? Gehört es nicht zum kirchlichen Markenkern, mir ein postmortales Gericht in Aussicht zu stellen?“
Ein kluges Buch, das die Fragen mehr liebt als die Antworten, aber vielleicht gerade dadurch dazu einlädt, das eigene Bekenntnis zu überprüfen.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Sibylle Knauss:
Der Glaube, die Kirche und ich
Alfred Kröner Verlag 2022, 160 Seiten, 16,00 Euro
Im Dienst der Hoffnung
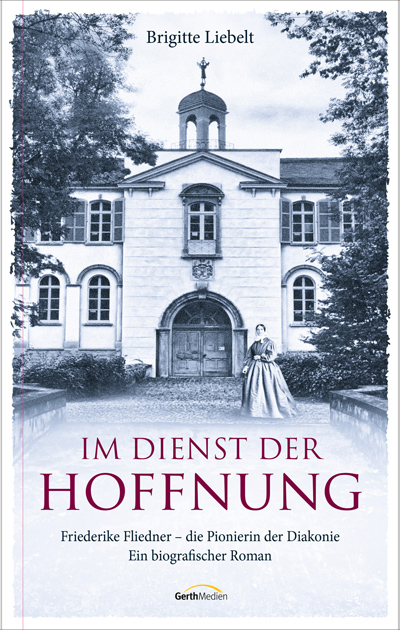 Friederike Fliedner war tatsächlich eine Frau „im Dienst der Hoffnung“, wie es der Titel des biografischen Romans zusammenfasst. Friederike Fliedner, die als ältestes von sieben Kindern nach dem Tod ihrer Mutter schon so früh Verantwortung übernehmen muss, wird nie ihre Hoffnung auf Gottes Hilfe verlieren. Auch und gerade dann nicht, wenn das Leben sie hart angreift.
Friederike Fliedner war tatsächlich eine Frau „im Dienst der Hoffnung“, wie es der Titel des biografischen Romans zusammenfasst. Friederike Fliedner, die als ältestes von sieben Kindern nach dem Tod ihrer Mutter schon so früh Verantwortung übernehmen muss, wird nie ihre Hoffnung auf Gottes Hilfe verlieren. Auch und gerade dann nicht, wenn das Leben sie hart angreift.
Brigitte Liebelt erzählt die Lebensgeschichte Friederike Fliedners, und sie schafft es eindrucksvoll, diese Frau, ihre Familie und die gesellschaftlichen Bedingungen lebendig werden zu lassen. So ist das Buch nicht nur eine spannende Biografie, sondern gibt auch einen guten Einblick in die sozialen Probleme des beginnenden Industriezeitalters und die Entstehung der Kaiserswerther Diakonie.
1828 heiratet Friederike den Pfarrer Theodor Fliedner und folgt ihm nach Kaiserswerth. Er hatte um sie geworben, in der Erwartung, dass sie ihn bei seinen unermüdlichen Einsätzen für die Armen, für Kranke, für Kinder, für alle Bedürftigen, die Gott ihnen anvertrauen wollte, tatkräftig unterstützen würde.
Und das tat Friederike auch. Oft über ihre Kräfte hinaus. Ihr erstes gemeinsames Projekt war ein Asyl für entlassene weibliche Strafgefangene, bald kam eine Kleinkinderschule dazu, weil sie das Übel der Verwahrlosung an der Wurzel angehen wollten. Zusammen entwickelten die Fliedners schließlich das Konzept für ein Diakonissenamt und gründeten die Diakonissenanstalt Kaiserswerth.
Friederike wurde Ausbildnerin der Diakonissen und übernahm bald auch das Amt der Vorsteherin im Diakonissenhaus. Das Buch von Brigitte Liebelt verschweigt nicht die Überforderung bei all den Aufgaben, die Friederike zu erfüllen hatte. Theodor Fliedner war oft auf Reisen, um Spenden einzuwerben, und so war Friederike auf sich allein gestellt mit der Leitung der Anstalt, den vielen alltäglichen Fragen in der Ausbildung der jungen zukünftigen Diakonissen, dem Pfarrhaushalt und ihrer Familie. Zehn Kinder brachte sie zur Welt, nur drei haben das Erwachsenenalter erreicht. An den Folgen der Frühgeburt ihres elften Kindes starb Friederike am 22. April 1842 im Alter von 42 Jahren.
In allen Nöten und Sorgen rechnete Friederike Fliedner jederzeit fest mit der Hilfe Gottes. Ihr starker persönlicher Glaube an den lebendigen Gott gab ihr die Kraft, das enorme Arbeitspensum zu bewältigen, bei allen Zerreißproben nicht zu verzweifeln und „im Dienst der Hoffnung“ zu bleiben. Ein beeindruckendes Glaubenszeugnis!
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Brigitte Liebelt:
Im Dienst der Hoffnung. Friederike Fliedner – die Pionierin der Diakonie
Gerth Medien 2022, 350 Seiten, 20,00 Euro
Kaputte Wörter?
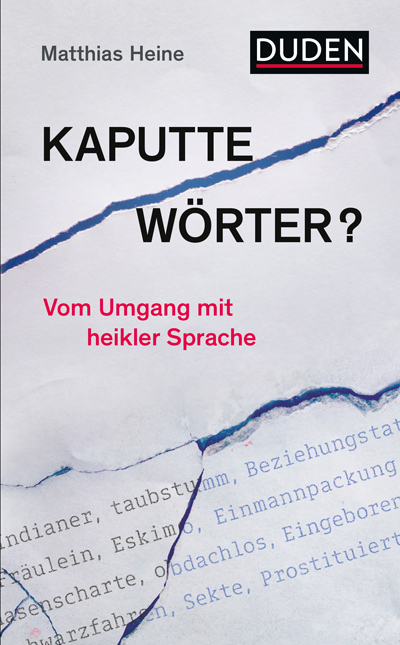 Der Journalist Matthias Heine hat sich 80 Wörter vorgenommen, die problematisch geworden sind. Sie sind „kaputt“, weil sie, so der Autor, „wenn man sie unbedacht benutzt, möglicherweise unerwünschte Kommunikationsstörungen auslösen“. Daraus kann heutzutage schnell ein Shitstorm mit schrillen Tönen werden. „Früher verhallte ein rassistisches oder sexistisches Wort meist im engen Echoraum des Stammtischs, der familiären Kaffeetafel oder der Bierzeltrede“, schreibt Heine, „heute ist der unsympathische Onkel, der allen auf den Wecker geht, weil er darauf beharrt, weiterhin Neger zu sagen, bei Facebook oder Twitter aktiv. Und ihm gegenüber sitzt nicht mehr nur eine einzige Nichte, die gern auch den Rest der Verwandtschaft darüber aufklärt, was man neuerdings – jenseits solcher unumstrittenen No-Gos – alles nicht mehr sagen soll, sondern ein Heer von Sprachwächtern.“
Der Journalist Matthias Heine hat sich 80 Wörter vorgenommen, die problematisch geworden sind. Sie sind „kaputt“, weil sie, so der Autor, „wenn man sie unbedacht benutzt, möglicherweise unerwünschte Kommunikationsstörungen auslösen“. Daraus kann heutzutage schnell ein Shitstorm mit schrillen Tönen werden. „Früher verhallte ein rassistisches oder sexistisches Wort meist im engen Echoraum des Stammtischs, der familiären Kaffeetafel oder der Bierzeltrede“, schreibt Heine, „heute ist der unsympathische Onkel, der allen auf den Wecker geht, weil er darauf beharrt, weiterhin Neger zu sagen, bei Facebook oder Twitter aktiv. Und ihm gegenüber sitzt nicht mehr nur eine einzige Nichte, die gern auch den Rest der Verwandtschaft darüber aufklärt, was man neuerdings – jenseits solcher unumstrittenen No-Gos – alles nicht mehr sagen soll, sondern ein Heer von Sprachwächtern.“
Was in solchen hitzigen Diskussionen meist untergeht, ist ein genauer Blick auf die Wörter, die ausgemerzt werden sollen. Wo kommen sie her? Was war ihre ursprüngliche Bedeutung und was wird heute an ihnen kritisiert? Mit diesen Fragen geht Heine an die Wörter heran und fördert so manch Überraschendes zu Tage.
Er ordnet die Wörter alphabetisch, von A wie Abtreibung bis Z wie Zwerg; er fasst zu jedem Begriff Ursprung, Gebrauch, Kritik und seine eigene Einschätzung zusammen.
Es gibt in dieser Liste Wörter, die sind wirklich „kaputt“. Dass Begriffe wie Fräulein, Liliputaner oder mongoloid nicht mehr im Sprachgebrauch sind, ist gut so.
Es gibt die üblichen Verdächtigen wie: Eskimo, farbig, Indianer, Neger, Zigeuner. Und es stehen auch unerwartete Wörter auf Heines Liste: Altes Testament, Jude, Curry, Weihnachten. Ja, sie sind auch „verdächtig“, und an etlichen Auseinandersetzungen um den „richtigen“ Sprachgebrauch lassen sich, wenn man genauer hinschaut, dann eben auch Irrwege erkennen.
Matthias Heine will zum Nachdenken anregen. Er ist kein Sprachpolizist, sondern einer, der Sprache bewusst macht. Sein Buch ist ein guter Beitrag für eine Versachlichung auf dem „unübersichtlichen Terrain der Sprachkämpfe“.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Matthias Heine:
Kaputte Wörter? Vom Umgang mit heikler Sprache
Duden Verlag 2022, 302 Seiten, 22,00 Euro
Die Leipziger Mission und die Dalit-Christen in Pandur, Tamil Nadu
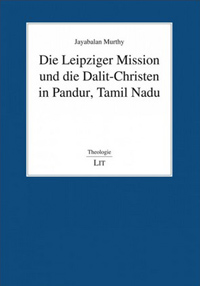 Zwei in der Missionswissenschaft diskutierte Fragen bearbeitet Pfr. Jayabalan Murthy von der Tamil Evangelical Lutheran Church, Indien, in seiner Magisterarbeit an der Georg August Universität Göttingen: einmal die in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder geäußerte Frage, inwieweit christlichen Missionsgesellschaften, in diesem Fall die Leipziger Mission, auch kolonialistische Motive bewegten, und zweitens die erst in neuerer Zeit gestellte Frage, wie diejenigen, die durch die Missionsbemühungen Christen geworden sind, die Geschichte beurteilen.
Zwei in der Missionswissenschaft diskutierte Fragen bearbeitet Pfr. Jayabalan Murthy von der Tamil Evangelical Lutheran Church, Indien, in seiner Magisterarbeit an der Georg August Universität Göttingen: einmal die in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder geäußerte Frage, inwieweit christlichen Missionsgesellschaften, in diesem Fall die Leipziger Mission, auch kolonialistische Motive bewegten, und zweitens die erst in neuerer Zeit gestellte Frage, wie diejenigen, die durch die Missionsbemühungen Christen geworden sind, die Geschichte beurteilen.
Es ist recht ungewöhnlich, dass eine Masterarbeit veröffentlicht wird, in diesem Fall bieten aber gerade der notwendigerweise begrenzte Umfang und die fokussierten Fragestellungen den „Blick durchs Schlüsselloch“. Wie unter einem Brennglas wird das, was die Kirchengeschichte als „Kastenstreit“ bezeichnet, konkret an einer Gemeinde in einer überschaubaren Region dargestellt. Auch die Zahl der Protagonisten ist klein, sodass es gelingt, einen etwas tiefergehenden Eindruck zu vermitteln. Erfreulich ist es, dass es dem Verfasser gelingt, sich von den Quellen aus dem 19. Jahrhundert in der Darstellung zu lösen, wiewohl er sie erkennbar gelesen hat. Auch zum Hintergrund und der religiösen Verflechtung des Kastenwesens in Indien, sowie der heutigen Situation, kann man Interessantes erfahren, ein wenig Hintergrundwissen ist allerdings Voraussetzung.
Es ist wissenschaftlich gesehen immer spannend, wenn lange geglaubte und gelehrte Thesen infrage gestellt werden. In diesem Fall ist es die Annahme, dass die Leipziger Mission im Gegensatz zur Hermannsburger Mission (und anderen) im 19. Jahrhundert in der Frage des Kastenwesens kompromissbereiter gewesen sei und dass sie damit in gewisser Weise „auf der falschen Seite stand“. Die gegenseitigen Verwerfungen ließen damals auch nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Das hatte damit zu tun, dass in der Hermannsburger Mission der Grundsatz galt – so hat Louis Harms es immer wieder eingeschärft –, dass sich die Verhältnisse nach dem Wort Gottes zu richten hätten und nicht umgekehrt. Darum ging es im „Kastenstreit“ – ein durchaus relevantes Thema im 19. Jahrhundert. Es gelingt nun Jayabalan Murthy zu zeigen, dass es so eindeutig eben nicht war, sondern er kann am Beispiel eines Missionars, Johannes Kabis, aufzeigen, wie das missionarische, diakonische und gesellschaftliche Wirken in diesem Fall zur Überwindung von Kastenschranken beitrug, und zwar, indem es die zu Christen gewordenen „Dalits“, die Unberührbaren, mit Selbstvertrauen und Würde beschenkte, die Kraft zur Veränderung gab. Auch die Rolle der von Missionaren gegründeten Schulen spielt hier eine wichtige Rolle.
Was diese Masterarbeit leider nicht leistet, ist eine vertiefte Einordnung in den kirchengeschichtlichen und konfessionellen Kontext der Leipziger Mission und den Gegensatz zur Hermannsburger Mission, zumal der Verfasser diese Kontexte kennt. Das würden sich Leser aus den Reihen unserer Kirche sicherlich wünschen.
Es ist aber zu hoffen, dass eine in einer Dissertation geleistete Weiterarbeit hier mehr Bezüge bietet. Auf jeden Fall darf man auf eine solche Dissertation gespannt sein.
Rezension von Andrea Grünhagen
Jayabalan Murthy:
Die Leipziger Mission und die Dalit-Christen in Pandur, Tamil Nadu
In: Theologie, Band 121, Berlin 2022, ISBN: 978-3-643-91294-7, Broschüre, 92 Seiten, 29,90 Euro
Kleefelder Notizen
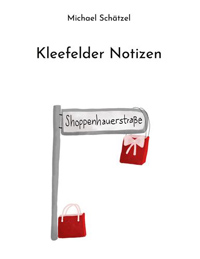 Ein Coffee Table Book für den weihnachtlichen Gabentisch
Ein Coffee Table Book für den weihnachtlichen Gabentisch
„Coffee Table Book“ nennt man Bücher, die man auf den Couchtisch legt, damit man beim gemütlichen Kaffeetrinken darin blättern kann. Michael Schätzels „Kleefelder Notizen“ darf ich hier für den weihnachtlichen Gabentisch empfehlen.
Doch von vorn: „Bei uns im Kirchenbüro in Hannovers schönem Stadtteil Kleefeld …“ heißt es gleich zu Beginn auf Seite 11, und damit ist auch der Ton gesetzt. Mit einer wunderbaren Heiterkeit und Leichtigkeit erzählt Michael Schätzel von kleinen alltäglichen Ereignissen, von der Zeitungsfrau, von der Nachbarschaft, von kleinen Lesefrüchten. Die „Kleefelder Notizen“ erschienen in dieser Zeitschrift „Lutherische Kirche“ in den Jahren 2013 bis 2020. Wir haben sie geliebt und schon damals mit Freude gelesen, war es doch immer, als ginge auch am regnerischsten Novembertag für einen Moment des Lesens die Sonne auf. Und unsere Leserinnen und Leser haben diesen liebevollen Blick durch den Türspalt des Kirchenbüros sehr geschätzt. Der christliche Glaube steht bei den Kleefelder Notizen nicht im Vordergrund, sondern im Hintergrund. Damit will ich sagen, dass der Glaube, der den Verfasser trägt, als Grundton auf jeder Seite mitschwingt und klingt, aber sich – sozusagen – nicht in den Vordergrund drängt.
Ach ja, die Illustrationen! Dörte Schätzel hat für jeden Jahrgang der „Kleefelder Notizen“ wundervolle Bilder gestaltet. Weitere Illustrationen sind eingestreut, die die Heiterkeit der dazugehörigen Texte aufgreifen. Die Handschrift der Künstlerin erinnert mich besonders in der Farbgebung ein wenig an Landhausstil – sehr gelungen.
Im zweiten Korintherbrief kann man von „Gehilfen der Freude“ lesen (2. Korinther 1, 24). Für mich sind die Kleefelder Notizen Gehilfen der Freude.
Rezension von Hans-Jörg Voigt
Michael Schätzel:
Kleefelder Notizen - mit Illustrationen von Dörte Schätzel
Herausgegeben von Dörte Schätzel und Christoph Barnbrock
Hardcover, 124 Seiten, ISBN-13: 9783756206469, Verlag: Books on Demand, 18,90 Euro und als E-BOOK 2,99 Euro
Luther übersetzt
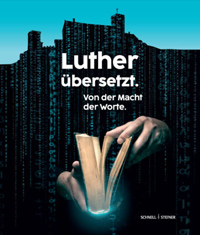 Luther übersetzt – das klingt nach Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Tatsächlich präsentiert sich die Geschichte der Bibelübersetzung im Begleitband zur Sonderausstellung „500 Jahre Neues Testament auf der Wartburg“ (4.–6. November 2022) als unabschließbarer Prozess, der bis in die Zukunft reicht. Luthers Übersetzung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache wird in diesem Band als bedeutender Meilenstein gewürdigt, weil er Gottes Wort mit der Volkssprache nicht nur erstmals theologischen Laien zugänglich gemacht, sondern auch die junge Buchdruckerkunst mit immer neuen Aufträgen versorgt hat.
Luther übersetzt – das klingt nach Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Tatsächlich präsentiert sich die Geschichte der Bibelübersetzung im Begleitband zur Sonderausstellung „500 Jahre Neues Testament auf der Wartburg“ (4.–6. November 2022) als unabschließbarer Prozess, der bis in die Zukunft reicht. Luthers Übersetzung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache wird in diesem Band als bedeutender Meilenstein gewürdigt, weil er Gottes Wort mit der Volkssprache nicht nur erstmals theologischen Laien zugänglich gemacht, sondern auch die junge Buchdruckerkunst mit immer neuen Aufträgen versorgt hat.
In zehn Aufsätzen, die den Erläuterungen einzelner Exponate vorangehen, nähern sich unter anderem Theologen, Kirchenhistoriker, Sprach- und Musikwissenschaftler unter verschiedensten Blickwinkeln der epochalen Leistung der Bibelübersetzung. Sie wird fassbar in den immer neuen Revisionen, die zwischen 1521 und heute gedruckt worden sind und den Wandel sprachlicher, theologischer und gesellschaftlicher Vorstellungen spiegeln.
Aber was heißt überhaupt „Übersetzen“ oder – wie Luther es nannte – „Dolmetschen“? Sicher nicht, den Text Wort für Wort einfach von der einen in die andere Sprache zu übertragen. Der erste Beitrag von Thomas Kaufmann beschreibt, wie sich Luther zwischen griechisch-deutschen Wörterbüchern, älteren zweisprachigen Bibelausgaben und zeitgenössischen Kommentarwerken der eigentlichen Schwierigkeit seines Übersetzungsvorhabens schmerzhaft bewusst wurde und ein leitendes Prinzip finden musste. Er sah es in der rechtfertigenden Tat Jesu Christi und in den entsprechenden Texten des Evangeliums und der Apostel. Gleichwohl brachte jeder neue Begriff die Vieldeutigkeit und Unschärfe älterer Übersetzungen zum Vorschein. Andererseits schien es für einige in Luthers Augen wichtige Sachverhalte noch keinen treffenden Ausdruck zu geben, wie das Beispiel der Übersetzung des Römerbriefs zeigt. Das „allein durch den Glauben“ (Römer 3,28) jedenfalls fand sich in keiner der kirchlich approbierten griechischen oder lateinischen Fassungen des Neuen Testaments. Denn dort war Anschaulichkeit auch noch kein Thema. Erst Luthers volkssprachliche „Wörter- und Wortewelt“, in die der Beitrag des Germanisten Jens Haustein einführt, förderte die nachhaltige Aneignung des Evangeliums und prägte Sprichwörter und Redewendungen wie jene vom „Licht unterm Scheffel“. Diesen altertümlichen Ausdruck für einen Hohlmaß-Behälter einfach durch das moderne Wort „Eimer“ zu ersetzen, wie in einer Revision des Neuen Testaments von 1975, sorgte für viel Spott und war nicht durchsetzbar. Davon berichtet detailreich der lutherische Neutestamentler Christoph Kähler in seinem Beitrag über die Geschichte der kirchenamtlichen Revisionen der Lutherbibel bis 2017, die jeweils mit der grundsätzlichen Herausforderung der „Korrektur eines Klassikers“ verbunden waren. Für die Jubiläumsausgabe wurden nahezu 5000 verschüttete Formulierungen Luthers wieder aufgenommen und somit der „Macht der Worte“ des Reformators Rechnung getragen.
Einen wichtigen Beitrag zur Volkstümlichkeit des christlichen „Klassikers“ leisten aber auch „nicht-amtliche“ Übersetzungen wie die „Gute Nachricht Bibel“ (seit 1968), gesellschaftsbewusste Fassungen wie die „Bibel in gerechter Sprache“ (seit 2006) oder die aus der Jugendarbeit hervorgegangene Nacherzählung „Die „Volxbibel“ (seit 2009). Sie reichen laut Beitrag der Kulturwissenschaftlerin Dorothee Menke bis zu interaktiven Projekten auf digitaler Basis, die im Internet stattfinden und Bibel-Arbeit zu einer demokratischen Angelegenheit machen.
Abgerundet wird der spannende Streifzug durch die Geschichte der Bibelübersetzungen durch Abstecher in die musikalische Verarbeitung lutherischer Bibeltexte, in die Geschichte des Buchdrucks und in die Welt der frühmodernen Diskussionen um die „Verbesserung“ der Übersetzung. Thematisiert wird nicht zuletzt die Wartburg, die für gut zehn Monate Luthers Bewegungsradius, nicht aber die Weite seiner sprachlichen Leistungsfähigkeit einschränkte.
Insgesamt bietet der reich mit Fotos von Exponaten und Räumlichkeiten illustrierte und einem wissenschaftlichen Apparat ausgestattete Band eine beinahe unerschöpfliche Fundgrube für private oder akademische Erforschung lutherischer Bibelübersetzung zu einem mehr als angemessenen Preis.
Rezension von Anne Heinig
Begleitband zur Sonderausstellung „500 Jahre Neues Testament auf der Wartburg“ (4. Mai bis 6. November 2022)
Luther übersetzt. Von der Macht der Worte.
Verlag Schnell und Steiner, Regensburg 2022, 192 Seiten, 15 Euro
Die Gründungsgeschichte der SELK 1945-1972
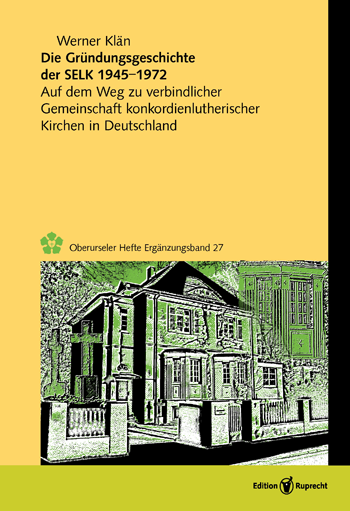 Wer schon einmal die Frage zu beantworten hatte, was die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) ausmacht und was sie von anderen Kirchen unterscheidet, wird nicht um Kirchengeschichte herumkommen. Und auch wenn heute über theologische Themen, über Strukturen und Ordnungen der Kirche gestritten wird, ist ein „Rückblick“ auf die Entstehungsgeschichte in jedem Fall unerlässlich.
Wer schon einmal die Frage zu beantworten hatte, was die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) ausmacht und was sie von anderen Kirchen unterscheidet, wird nicht um Kirchengeschichte herumkommen. Und auch wenn heute über theologische Themen, über Strukturen und Ordnungen der Kirche gestritten wird, ist ein „Rückblick“ auf die Entstehungsgeschichte in jedem Fall unerlässlich.
Im Juni 2022 feierte die SELK ihr 50jähriges Bestehen. Ja, es ist tatsächlich erst 50 Jahre her, dass sich drei bis dahin eigenständige lutherische Kirchen zur SELK zusammenschlossen. Und bis das 1972 möglich wurde, war es ein langer, beschwerlicher Weg.
Werner Klän, emeritierter Professor der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel und profunder Kenner der Geschichte lutherischer Kirchen, zeichnet in seinem neuen Buch die Entstehungsgeschichte der SELK von 1945 bis 1972 nach. Und so wie er die Zusammenhänge darstellt, versteht man auch, warum es noch nach dem Zweiten Weltkrieg Jahrzehnte dauerte, bis der Zusammenschluss endlich vollzogen werden konnte. Was wurde debattiert und gerungen damals! Es ging um theologische Fragen, ja klar. Aber oft ging es auch um kirchenpolitische Rahmenbedingungen, die eine Einigung besonders schwer machten.
Nach einer kurzen Skizzierung des Profils der SELK als konkordienlutherische Kirche gibt Werner Klän zunächst einen Überblick über die ersten 125 Jahre des Bestehens selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen, wie sie sich im 19. Jahrhundert ausbildeten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die geteilte Not zu Annäherungen der bisher getrennten lutherischen Kirchen in Deutschland. Besonders die Evangelisch-Lutherische Kirche Altpreußens (ELKA) und die Evangelisch-Lutherische Freikirche ELFK) hatten einen Großteil ihrer Kirchen und Gemeindeglieder verloren und waren gezwungen, sich neu zu organisieren. In der Folge verstärkten sich die Bemühungen um einen Zusammenschluss, und so führten die begonnenen Lehrverhandlungen zwischen der ELKA und der ELFK 1948 zur Verabschiedung der „Einigungssätze“, die im Einigungsprozess bis 1972 immer wieder eine herausragende Rolle spielen sollten.
Dieser Prozess der Annäherung wurde gleichzeitig beschleunigt durch die Entwicklungen im Raum der Landeskirchen hin zur Gründung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die von allen lutherischen Freikirchen einhellig als eine unierte Kirche identifiziert wurde.
Beschleunigt wurde der Prozess außerdem durch die Gründung der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel 1948 sowie der Zusammenarbeit der Kirchen auf dem Gebiet der Mission.
Nun hätte es doch zügig(er) voran gehen können mit dem Zusammenschluss aller selbstständigen lutherischen Kirchen, möchte man aus heutiger Sicht meinen – wenigstens im Westen Deutschlands. Doch es gab immer wieder Stolpersteine auf dem Weg zu einer Einigung. Welche Hindernisse das waren und wie in den folgenden Jahrzehnten trotzdem immer wieder und unermüdlich um eine Einigung gerungen wurde, schildert Werner Klän verständlich, spannend, nachvollziehbar.
Das lange Mühen, das „Dranbleiben“, nicht zuletzt die komplexe und aufwändige Erarbeitung einer Grundordnung für die neu entstehende SELK, nötigt einem großen Respekt und auch Demut ab. Beharrlich und mit viel Geduld führten die Bemühungen 1972 schließlich zum Zusammenschluss zur SELK.
Dass die Geschichte selbstständiger lutherischer Kirchen bis zur Gründung der SELK in diesem neuen Standardwerk nicht nur wie in einem Naschlagewerk zusammengestellt wurde, sondern durch das erklärende Darstellen der Zusammenhänge in ihrem Verlauf nachgezeichnet wird, ist das große Verdienst des Autors und macht das Buch auch für interessierte Laien verständlich.
Es ist nicht „trockene“ Kirchengeschichte, die hier wiedergegeben wird, das Buch macht neu klar, warum es die SELK als eigenständige konfessionell-lutherische Kirche nach wie vor (oder vielleicht mehr denn je) braucht. Dass sie gleichzeitig ihre „ökumenische Verantwortung“ darin ernst nimmt und ihre Positionen profiliert in die zwischenkirchlichen Gremien und Arbeitsgemeinschaften eintragen muss, betont Klän mehrfach. Er schließt sein Buch ab mit einem kurzen Kapitel zur „konfessionskundlichen Ortsbestimmung“ – mit Erläuterungen zum Namen der SELK als Programm und mit Hinweisen zu Herausforderungen, denen sie heute gegenübersteht.
Sich – zum Beispiel durch dieses Buch – der eigenen Wurzeln zu vergegenwärtigen, ist vielleicht nicht die schlechteste Voraussetzung, diesen Herausforderungen etwas zuversichtlicher entgegenzusehen.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Werner Klän:
Die Gründungsgeschichte der SELK 1945-1972
Auf dem Weg zu verbindlicher Gemeinschaft konkordienlutherischer Kirchen in Deutschland
Oberurseler Hefte, Ergänzungsband 27, erschienen bei Edition Ruprecht, Göttingen 2022, 256 Seiten, 64,00 Euro
Die Mission und Verkündigung des Apostels Paulus
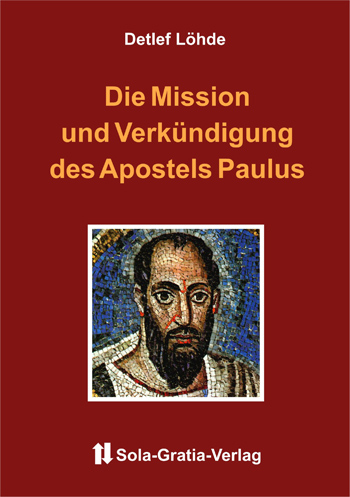 Neuen Paulusbüchern begegne ich in der Regel mit Skepsis. Es besteht immer die Gefahr, dass das uneingeschränkt gültige apostolische „Wort Gottes“ auf bloßes „Pauluswort“ reduziert wird, das heute nicht mehr so gelten, zumindest aber nicht mehr so verstanden werden könne. Nicht so bei diesem Buch. Beim ersten Anlesen schon ist es faszinierend, in Teilen sogar spannend und dazu noch in allgemeinverständlicher Sprache. Egal, ob man Angaben zu seiner Biografie sucht (Seite 152 ff.), Einleitungen zu seinen Briefen (Seite 135 ff.), Kenntnisse über die Stätten, die er im Laufe seiner Wirksamkeit berührt hat (Seite 161 ff.) oder auch das religiös-geistige Umfeld (Seite 155 ff.), immer setzt sich der Autor auch mit kritischen Auffassungen auseinander. Ein Wunder, dass es dabei vergleichsweise ein so dünnes Buch geblieben ist. Vor allem aber will der Verfasser, Pfarrdiakon in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), gemeindebezogen Dogmatik und Ethik, christliche Glaubens- und Lebensfragen, heutigen Christen verdeutlichen. Dabei scheut er sich nicht, aktuelle Probleme unserer Gesellschaft, wie Homosexualität, Antisemitismus, Frauen im Predigtamt und Ähnliches, anzugehen und im paulinischen Licht zu beleuchten. Im letzten Anhang schließlich (Seite 176), setzt er sich auch mit den neueren Theorien zum Paulusverständnis auseinander und auch das so, dass es für Laien verstehbar wird.
Neuen Paulusbüchern begegne ich in der Regel mit Skepsis. Es besteht immer die Gefahr, dass das uneingeschränkt gültige apostolische „Wort Gottes“ auf bloßes „Pauluswort“ reduziert wird, das heute nicht mehr so gelten, zumindest aber nicht mehr so verstanden werden könne. Nicht so bei diesem Buch. Beim ersten Anlesen schon ist es faszinierend, in Teilen sogar spannend und dazu noch in allgemeinverständlicher Sprache. Egal, ob man Angaben zu seiner Biografie sucht (Seite 152 ff.), Einleitungen zu seinen Briefen (Seite 135 ff.), Kenntnisse über die Stätten, die er im Laufe seiner Wirksamkeit berührt hat (Seite 161 ff.) oder auch das religiös-geistige Umfeld (Seite 155 ff.), immer setzt sich der Autor auch mit kritischen Auffassungen auseinander. Ein Wunder, dass es dabei vergleichsweise ein so dünnes Buch geblieben ist. Vor allem aber will der Verfasser, Pfarrdiakon in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), gemeindebezogen Dogmatik und Ethik, christliche Glaubens- und Lebensfragen, heutigen Christen verdeutlichen. Dabei scheut er sich nicht, aktuelle Probleme unserer Gesellschaft, wie Homosexualität, Antisemitismus, Frauen im Predigtamt und Ähnliches, anzugehen und im paulinischen Licht zu beleuchten. Im letzten Anhang schließlich (Seite 176), setzt er sich auch mit den neueren Theorien zum Paulusverständnis auseinander und auch das so, dass es für Laien verstehbar wird.
Das ansprechende und preiswerte Büchlein eignet sich nicht nur zum Selbststudium, sondern auch für gemeinsames Arbeiten in dafür geeigneten Gemeindekreisen.
Rezension von Johannes Junker
Detlef Löhde:
Die Mission und Verkündigung des Apostels Paulus, Was uns Paulus zu sagen hat
Sola-Gratia-Verlag Rotenburg (Wümme) 2022, ISBN 978-3-048712-15-0, 190 Seiten, 6,00 Euro
Gott ist einfach wunderbar
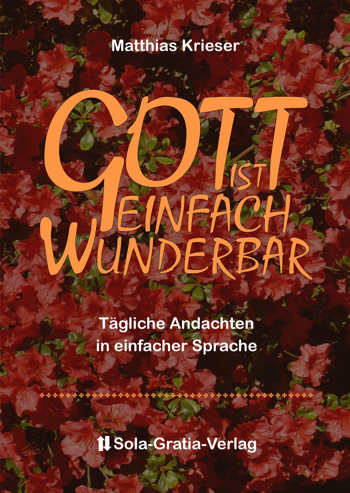 Das Angebot an Andachtsbüchern ist überschaubar; wer für die tägliche Andacht Texte lutherischer Autoren sucht, wird dieses Buch daher gern aufschlagen. Matthias Krieser, SELK-Pfarrer im Ruhestand, hat über 400 Andachtstexte verfasst, für jeden Tag des Jahres. Jede Andacht umfasst eine Seite, beginnt mit einem Bibelwort und endet mit einem Gebet.
Das Angebot an Andachtsbüchern ist überschaubar; wer für die tägliche Andacht Texte lutherischer Autoren sucht, wird dieses Buch daher gern aufschlagen. Matthias Krieser, SELK-Pfarrer im Ruhestand, hat über 400 Andachtstexte verfasst, für jeden Tag des Jahres. Jede Andacht umfasst eine Seite, beginnt mit einem Bibelwort und endet mit einem Gebet.
Der Autor betont, dass die Gedanken und Erklärungen zu dem Bibelwort „in einfacher Sprache“ gefasst seien. Das stimmt insofern, als kurze Sätze, kaum Fremdwörter, einfache Vergleiche und Bilder das Verstehen erleichtern. Aber die Sprache ist eben nicht derart „einfach“, dass sie dem biblischen Wort seine Tiefe, seine Komplexität, seine Stärke weg kürzt und die Botschaft simplifiziert. „Einfach“ sind die Texte, weil sie nicht den Zweifel mit ins Boot holen, sondern immer Christus-zentriert bleiben. „Einfach“ sind die Texte, weil sie auf das Ziel hinweisen und auf Gottes Handeln. Insofern sind sie einfach tröstlich, wie gute Verkündigung es immer ist.
Eine Anmerkung zur Aufmachung: Vermutlich haben Autor und Verlag als Zielgruppe vor allem auch eine ältere Leserschaft im Blick gehabt und daher ein A4-Format mit großer Schrift und festem Einband gewählt. Der Nachteil ist, dass das Buch dadurch sehr unhandlich und schwer geworden ist. In der Hand haltend oder im (Kranken-)Bett wird man es so wohl eher nicht nutzen.
Rezension von Gottfried Heyn
Matthias Krieser:
Gott ist einfach wunderbar. Tägliche Andachten in einfacher Sprache
Sola-Gratia-Verlag 2022, 412 Seiten, 21,00 Euro; erhältlich beim Verlag oder im Buchhandel
Als E-Book kostenlos über die Verlags-Website www.sola-gratia-verlag.de
Gläubig. Depressiv. Gehalten.
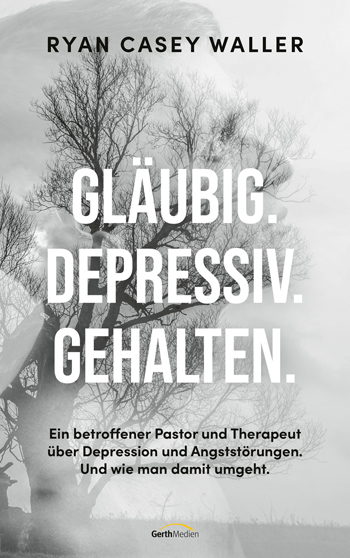 Über Depressionen zu sprechen fällt schwer, psychische Probleme verschweigt man lieber, denn sie sind oft mit Scham und Selbstvorwürfen behaftet. Wenn ein Pastor so schonungslos offen über seine Depression und Alkoholprobleme redet wie Ryan Casey Waller, kann das daher Betroffene entlasten und ermutigen. Denn seine wichtigste Botschaft lautet: „Sie sind nicht allein“.
Über Depressionen zu sprechen fällt schwer, psychische Probleme verschweigt man lieber, denn sie sind oft mit Scham und Selbstvorwürfen behaftet. Wenn ein Pastor so schonungslos offen über seine Depression und Alkoholprobleme redet wie Ryan Casey Waller, kann das daher Betroffene entlasten und ermutigen. Denn seine wichtigste Botschaft lautet: „Sie sind nicht allein“.
Waller beginnt sein Buch mit der beschämenden Szene seines psychischen Zusammenbruchs. An diesem Tag hatte er in angetrunkenem Zustand die Predigt gehalten und wankte anschließend zum Altar zurück. Da greifen Freunde und Gemeindeleiter ein. Er wird ins Hinterzimmer geführt. Seine Freunde sind besorgt. Sie fragen ihn, ob er getrunken habe, weil er während der Predigt gelallt hat und beinahe gestürzt wäre. Aber Waller leugnet noch immer und will zurück in die Kirche, er will nicht wahrhaben, dass es so nicht weitergehen kann.
Psychische Probleme werden oft selbst von Betroffenen verleugnet, nicht nur weil sie sich schämen, sondern weil sie auch auf wenig Verständnis hoffen können. „Jeder ist mal schlecht drauf“ kriegen sie zu hören, wenn sie andeuten, dass sie unter Depressionen leiden. Angstzustände? Zu viel Alkohol? Da wenden sich viele peinlich berührt eher ab, als dass sie es genauer wissen wollen.
Das ist unter Christen nicht besser, im Gegenteil: Vor allem in evangelikal geprägten Kreisen kriegen Betroffene zusätzlichen Druck zu spüren mit dem Hinweis, dass sie halt mehr beten sollen, mehr vertrauen, mehr Sünden bekennen … Hiob lässt grüßen.
Ryan Casey Waller, der mittlerweile als Therapeut arbeitet, nimmt mit seinem Buch dem psychischen Leiden jede Peinlichkeit. Weil er durch die Veröffentlichung seiner Geschichte zeigt, dass es jeden treffen kann – genauso wie ein Beinbruch, ein Herzinfarkt oder eine Krebserkrankung. Er litt jahrelang an Angstzuständen und Depressionen, schaffte es nur mit unglaublicher Kraftanstrengung – und immer öfter unter Alkohol, seinen Alltag zu überstehen. Und behauptete nach außen immer: Alles in Ordnung, mir geht es gut.
Das Buch ist ein Augenöffner. Es ist hilfreich, gerade weil der Autor seine persönlichen Erfahrungen beschreibt. Als Betroffener weiß er, wie schmerzhaft und schwierig der Kampf mit psychischen Störungen sein kann. Als Pastor und Psychotherapeut kann er die Symptome einordnen. Er spricht über Suizidgedanken und den Einsatz von Medikamenten, über professionelle therapeutische Hilfe und die Frage nach Gott in diesem Leiden. Und er macht deutlich, dass sich etwas ändern kann. Aber dafür braucht es das Gespräch, die heilende Kraft der Gemeinschaft. Auch dafür ist das Buch eine hilfreiche Ermutigung.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Ryan Casey Waller:
Gläubig. Depressiv. Gehalten
Gerth Medien 2022, 224 Seiten, 17,00 Euro
Wer spricht von Trost
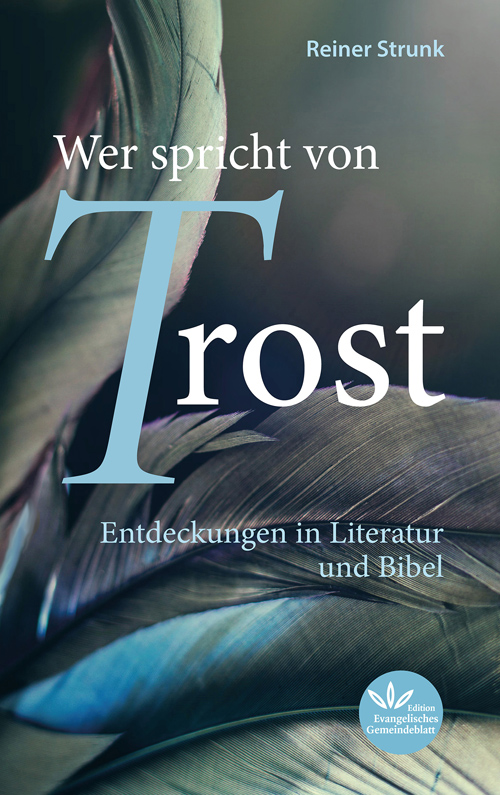 „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ So eindringlich fleht die Christenheit im Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ um Trost. So sehr brauchen wir Menschen diesen Trost, immer schon und auch und gerade in dieser Zeit. Wo bleibst du, wahrer Trost, der nicht nur vertröstet, nicht verharmlost und nicht beschwichtigt?
„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ So eindringlich fleht die Christenheit im Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ um Trost. So sehr brauchen wir Menschen diesen Trost, immer schon und auch und gerade in dieser Zeit. Wo bleibst du, wahrer Trost, der nicht nur vertröstet, nicht verharmlost und nicht beschwichtigt?
Zwei Bücher fragen danach, was Trost überhaupt ist. Was tröstet wirklich, wenn Leben beschädigt, gedemütigt oder sogar ausgelöscht wurde?
Der Schriftsteller und Theologe Reiner Strunk sucht darauf Antworten anhand von Beispielen in der Bibel, in Literatur, Philosophie und Kunst. Seine kluge und tiefgründige Analyse findet ein überzeugendes Fazit: „Das Geheimnis des Trostes und seiner Wirksamkeit ist die Aussicht auf Verwandlung“. Nicht das sich Abfinden mit dem Unabänderlichen tröstet, nicht das Beschwichtigen, nicht gut gemeinte Ratschläge zur Ablenkung. Wahrer Trost „muss das Erschrecken konterkarieren mit begründeter Zuversicht“.
Solcher Trost geschieht in der biblischen Josephsgeschichte, in der nach dem vermeintlichen Tod seines Lieblingssohnes der Vater untröstlich ist und seine Söhne ihn mit Lügen trösten wollen, was natürlich nicht funktioniert. Am Ende spendet Joseph echten Trost, der den verschreckten Brüdern einen Neuanfang (mit Gott) ermöglicht.
Solcher Trost geschieht andeutungsweise in Theodor Fontanes Effi Briest, als die unglückliche Effi kurz vor ihrem Tod den einzigen Menschen, der ihr zugetan geblieben ist, fragt, ob sie wohl in den Himmel komme. Und der, ihr Pastor Niemeyer, tröstet sie, indem er ihren Kopf in seine alten Hände nimmt, ihr einen Kuss auf die Stirn gibt und sagt: „Ja, Effi, du wirst“.
Solcher Trost geschieht bei Mose, bei Jona und Elia. Er geschieht in Texten von Heinrich Heine oder Mattias Claudius. In der Musik findet sich Trost, zum Beispiel in Johannes Brahms‘ Requiem.
Aber auch an Beispielen, in denen Trost an der Oberfläche bleibt – therapeutisches Placebo, philosophische Belehrung, billige Vertröstung – lässt sich etwas über Trost lernen. „Vertröstung narkotisiert, Trost antizipiert“, schreibt Reiner Strunk im Kapitel „Trost im Advent“, der ganz im Zeichen des nahenden, erlösenden Gottes steht. Das ist wahrer Trost, der verwandelt und lebendig macht! Das ist die Antwort auf die flehende Bitte „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ Niemand und nichts kann uns angesichts des Todes diesen Trost geben, als allein Christus. Daher singen Christen an Ostern und an den Gräbern: „Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein“.
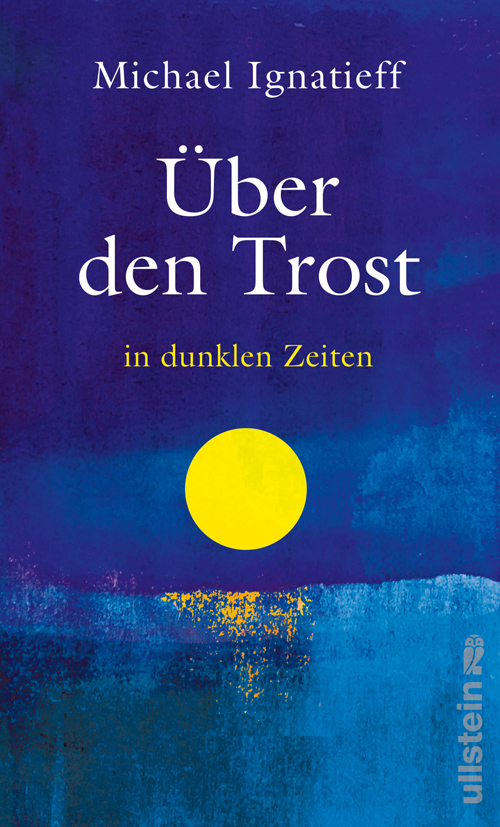 Von diesem Trost kann der Autor Michael Ignatieff in seinem Buch „Über den Trost“ nur als distanzierter Nichtgläubiger berichten. Zwar ist er selbst überrascht, dass ihn die Psalmen, insbesondere in ihren Vertonungen, trösten. Er versucht daher zu verstehen, wie „diese uralte religiöse Sprache uns so verzaubert hatte“. Immerhin bleibt da ein Staunen, eine Irritation, dass biblische Texte ihn anrühren können. Wirklich erklären kann er sich den „Zauber“ nicht. Er sucht andere „Tröstungsbemühungen“ an Beispielen von Texten und Porträts, von Cicero, Marc Aurel, Karl Marx, Albert Camus und vielen anderen.
Von diesem Trost kann der Autor Michael Ignatieff in seinem Buch „Über den Trost“ nur als distanzierter Nichtgläubiger berichten. Zwar ist er selbst überrascht, dass ihn die Psalmen, insbesondere in ihren Vertonungen, trösten. Er versucht daher zu verstehen, wie „diese uralte religiöse Sprache uns so verzaubert hatte“. Immerhin bleibt da ein Staunen, eine Irritation, dass biblische Texte ihn anrühren können. Wirklich erklären kann er sich den „Zauber“ nicht. Er sucht andere „Tröstungsbemühungen“ an Beispielen von Texten und Porträts, von Cicero, Marc Aurel, Karl Marx, Albert Camus und vielen anderen.
Wenn Michael Ignatieff sich mit Hiob, mit den Psalmen, mit dem Apostel Paulus beschäftigt, sucht er – anders als Reiner Strunk – nicht die verwandelnde Kraft im Trost, sondern ihm reichen die Hilfsmittel, die es erleichtern, weiterzumachen. Seine Porträts sind spannend zu lesen – wirklich tröstlich sind sie nicht. Ihnen fehlt die Kraft zur Verwandlung, die Reiner Strunk in seinem Buch immer wieder sucht und findet. Das Fazit von Michael Ignatieff gibt sich mit sehr viel weniger zufrieden: „Welche Erkenntnis können wir für Zeiten der Dunkelheit gewinnen? Wir lernen etwas ganz Einfaches: Wir sind nicht allein und sind es nie gewesen."
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Reiner Strunk:
Wer spricht von Trost. Entdeckungen in Literatur und Bibel
Edition Evang. Gemeindeblatt im Evangelischen Verlag Stuttgart 2020, 184 Seiten, 16,95 Euro
Michael Ignatieff
Über den Trost in dunklen Zeiten
Ullstein Verlag 2021, 347 Seiten, 24,00 Euro
Zur Antwort bereit
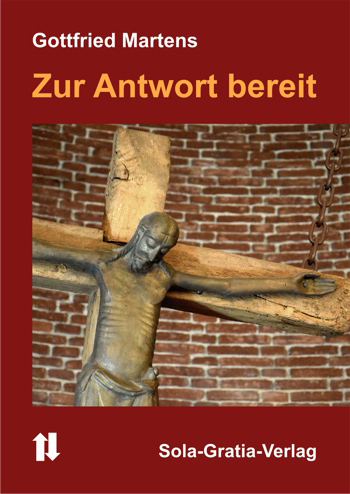 Wer kennt sie nicht, die Argumente gegen den christlichen Glauben: Die Wissenschaft habe den Glauben längst widerlegt. Jeder solle seinen eigenen Glauben haben. Man könne doch heute nicht mehr an die Bibel glauben. Und Christ sein gehe auch ohne Kirche …
Wer kennt sie nicht, die Argumente gegen den christlichen Glauben: Die Wissenschaft habe den Glauben längst widerlegt. Jeder solle seinen eigenen Glauben haben. Man könne doch heute nicht mehr an die Bibel glauben. Und Christ sein gehe auch ohne Kirche …
Die Einwände sind nicht neu, aber sie scheinen selbst in Kirche und Gemeinden zunehmend (wieder) zu verfangen. Klingt doch ganz plausibel, dass es die Wahrheit nicht gibt und jeder nach seiner Façon selig werden soll, oder nicht? Und was entgegnet man, wenn einem vorgehalten wird, dass es einen Gott, der so viel Leid zulässt, nicht geben könne? Dass die Bibel heutigen Erfahrungen und Erkenntnissen widerspreche? Dass Jesu Auferstehung sich nicht beweisen lasse und die Hölle eine Erfindung der Menschen sei?
Ja, was antworten, wenn man als Christ nach dem eigenen Glauben gefragt wird? Dr. Gottfried Martens, evangelisch-lutherischer Gemeindepfarrer in Berlin, hatte vor einiger Zeit für seine damalige Gemeinde Texte verfasst, die die wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens erklären.
Unter dem Titel „Woran ich glaube“ erläutert Martens entlang dem Glaubensbekenntnis die Basics des christlichen Glaubens. Er tut das anschaulich, anregend, inspirierend, so dass man den eigenen Glauben selbst wieder besser versteht, darin bestärkt und dann eben auch auskunftsfähig wird. Denn nur wer seinen Glauben kennt, kann auch Zeugnis darüber ablegen.
In einem zweiten Teil antwortet der Autor auf häufige Argumente gegen den Glauben. Er ordnet ein, rückt zurecht, entlarvt – eindeutig, aber ohne Polemik, kenntnisreich und nachvollziehbar.
Dass manche dieser Texte mittlerweile vielerorts in Gemeindebriefen abgedruckt wurden zeigt, wie groß das Bedürfnis nach verständlichen, fundierten, klaren Erklärungen ist. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass sie jetzt zusammengestellt als Buch herausgegeben wurden.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Gottfried Martens:
Zur Antwort bereit. Hilfen zum Gespräch über den christlichen Glauben
Sola-Gratia-Verlag 2022, 120 Seiten, 6,00 Euro; erhältlich beim Verlag oder im Buchhandel.
Als E-Book kostenlos über die Verlags-Website www.sola-gratia-verlag.de
Middlemarch
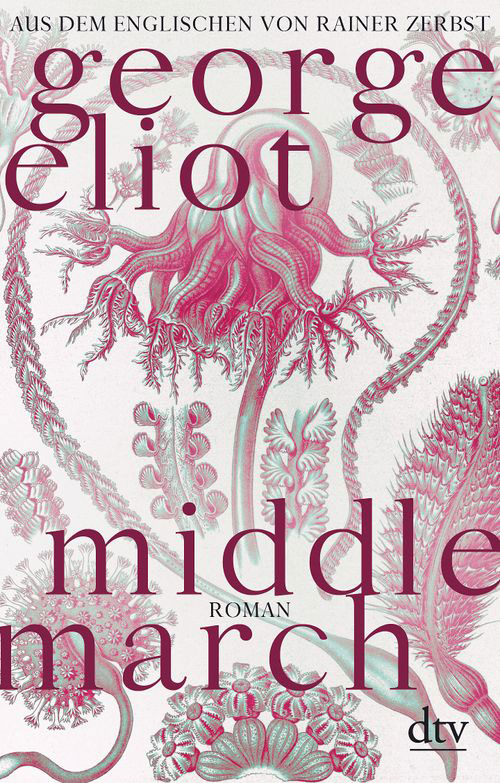 Es gibt Bücher, in die taucht man ein, sobald man zu lesen beginnt. Sie versetzen einen in ein anderes Leben, das einem selbst genügend fremd ist, um neugierig zu werden und gleichzeitig so nah, um sich selbst darin gespiegelt zu finden. Middlemarch ist so ein Buch. George Eliot, die Autorin, lebte im 19. Jahrhundert in England und hieß eigentlich Mary Ann Evans. Sie legte sich ein männliches Pseudonym zu, um ihre literarische Karriere zu befördern.
Es gibt Bücher, in die taucht man ein, sobald man zu lesen beginnt. Sie versetzen einen in ein anderes Leben, das einem selbst genügend fremd ist, um neugierig zu werden und gleichzeitig so nah, um sich selbst darin gespiegelt zu finden. Middlemarch ist so ein Buch. George Eliot, die Autorin, lebte im 19. Jahrhundert in England und hieß eigentlich Mary Ann Evans. Sie legte sich ein männliches Pseudonym zu, um ihre literarische Karriere zu befördern.
Mit Middlemarch inszeniert sie eine Kleinstadt in Mittelengland um 1830. Sie setzt Figuren in diese Szenerie hinein, die sofort lebendig werden. Die Schicksale, die sie nach und nach miteinander verwebt, rühren einen an. Man leidet mit den Menschen, deren Pläne und Hoffnungen zerrinnen, deren Beziehungen geprägt sind von Konventionen und Vorurteilen. Eine der Hauptfiguren ist die verwaiste Dorothea Brooke, die sich nach einem hehren geistigen Leben sehnt und glaubt, dieses in der Ehe mit dem älteren Pastor Casaubon zu finden. Der Geistliche, der sich in seiner fruchtlosen Forschung über Mythologien verloren hat, entpuppt sich aber schnell als liebloser, eifersüchtiger Gelehrter, dem Dorotheas Wissensdurst, den er zunächst als Bewunderung genossen hatte, schnell lästig wird.
Dann ist da auf der anderen Seite der zugezogene junge Arzt Tertius Lydgate. Er ist ambitioniert, idealistisch, schert sich scheinbar nicht um Standesdünkel und Gepflogenheiten. Er will den Kranken helfen, neue medizinische Methoden einführen, baut ein Krankenhaus auf. Und heiratet – die falsche Frau. Das sind nur zwei Schicksale, die mit vielen anderen verknüpft werden: Verwandte, Nachbarn, Pfarrer, Ärzte, der Bankier, Politiker, Gutsbesitzer – sie alle gehören zu diesem Kosmos. Sie sind aufeinander angewiesen und stoßen sich ab. Sie wissen um ihre Schuld und versuchen irgendwie durchzukommen. Sie wollen geliebt werden und finden doch keine Ruhe. Wie im richtigen Leben halt.
Was diesen wunderbaren Roman auszeichnet, ist die Präzision, mit der die Psychologie der Figuren entwickelt wird. In nur wenigen Sätzen wird eine Gemütslage offenbart, werden Hoffnungen angedeutet und verborgene Ängste konkret.
Man kann gar nicht anders, als alle diese Figuren mit großer Sympathie zu begleiten, mit ihnen das Scheitern von Plänen zu erleiden und doch auf einen Ausweg zu hoffen. Und ganz nebenbei erfährt man sehr viel Wissenswertes über die damalige politische Situation, über das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft und die Glaubenspraxis im viktorianischen England.
Die Sprachkunst dieser hierzulande viel zu unbekannten Autorin ist unvergleichlich. Ihr Humor ist es auch. Anlässlich ihres 200. Geburtstags 2019 erschienen zwei Neuausgaben mit unterschiedlichen Übersetzungen ihres großen Romans, die nun auch als Taschenbücher erhältlich sind. Wer dicke kluge, unterhaltsame Schmöker mag, muss Middlemarch lesen. Über 1000 Seiten reines Lesevergnügen!
Rezension von Doris Michel-Schmidt
George Eliot:
Middlemarch. Eine Studie aus dem Leben in der Provinz.
Roman. Aus dem Englischen von Rainer Zerbst.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Taschenbuch-Ausgabe, München 2021. 1150 Seiten, 14,90 Euro
George Eliot:
Middlemarch. Eine Studie über das Leben in der Provinz.
Roman. Aus dem Englischen von Melanie Walz.
Rowohlt Verlag, Taschenbuchausgabe Hamburg 2021, 1264 Seiten, 20,00 Euro
Wir waren Glückskinder – trotz allem
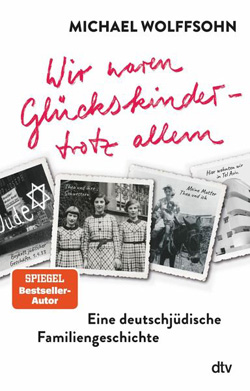 Weil sein siebenjähriger Enkel Noah „mehr über Juden und Hitler wissen“ will, schreibt Michael Wolffsohn, der Professor für Neuere Geschichte und preisgekrönte Autor sein erstes Jugendbuch. Er erzählt die Geschichte seiner Mutter Thea Saalheimer, die mit ihrer Familie vor dem Naziterror nach Tel Aviv flieht. Wie sie sich verliebt in Max Wolffsohn und mit ihm ein neues Leben aufbaut. „Im Jahr zwei nach Hitler“ wird ihr Sohn Michael geboren. 1954 kehren sie nach Deutschland zurück.
Weil sein siebenjähriger Enkel Noah „mehr über Juden und Hitler wissen“ will, schreibt Michael Wolffsohn, der Professor für Neuere Geschichte und preisgekrönte Autor sein erstes Jugendbuch. Er erzählt die Geschichte seiner Mutter Thea Saalheimer, die mit ihrer Familie vor dem Naziterror nach Tel Aviv flieht. Wie sie sich verliebt in Max Wolffsohn und mit ihm ein neues Leben aufbaut. „Im Jahr zwei nach Hitler“ wird ihr Sohn Michael geboren. 1954 kehren sie nach Deutschland zurück.
Michael Wolffsohn findet eine Sprache, die auch junge Leser verstehen. Seine Eltern und Großeltern hatten Glück, weil sie rechtzeitig fliehen konnten. Aber das Grauen des millionenfachen Mordens bleibt der Hintergrund dieser Familiengeschichte. Sehr lesenswert, nicht nur für Jugendliche!
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Michael Wolffsohn:
Wir waren Glückskinder – trotz allem. Eine deutschjüdische Familiengeschichte
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2021. 240 Seiten, 14,95 Euro
Geheiligt werde dein Name
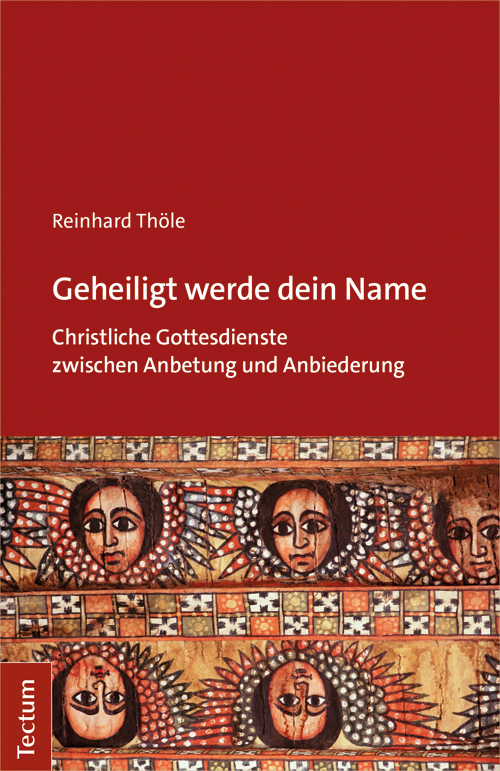 Der Umgang der Kirchen mit ihren Gottesdiensten verrät mehr über sie selbst, als ihnen lieb ist. Ist dem Gottesdienst das Heilige abhandengekommen? Reinhard Thöles Blick auf die Gottesdienstpraxis jedenfalls ist ernüchternd. Moderne experimentelle Formen sollen das eigene Milieu bei Laune halten. Da wird munter „gestaltet“ mit Versatzstücken aus einer Materialkiste, die sich speist aus tradierten Formen, aus anderen Konfessionen oder gar Religionen.
Der Umgang der Kirchen mit ihren Gottesdiensten verrät mehr über sie selbst, als ihnen lieb ist. Ist dem Gottesdienst das Heilige abhandengekommen? Reinhard Thöles Blick auf die Gottesdienstpraxis jedenfalls ist ernüchternd. Moderne experimentelle Formen sollen das eigene Milieu bei Laune halten. Da wird munter „gestaltet“ mit Versatzstücken aus einer Materialkiste, die sich speist aus tradierten Formen, aus anderen Konfessionen oder gar Religionen.
Thöle, emeritierter Professor für Ostkirchenkunde an der Theologischen Fakultät Halle-Wittenberg, entwirft in seinem neuen Buch eine Art Psychogramm des Gottesdienstes. Das ist viel mehr – und viel spannender zu lesen – als eine liturgiegeschichtliche Abhandlung. Reinhard Thöle ist ein profunder Kenner sowohl der römisch-katholischen als auch der evangelischen sowie der orthodoxen Tradition und Praxis. Und er ist ein exzellenter Beobachter. „Zeige mir den Gottesdienst, den du feierst, und ich sage dir nicht nur, welche Theologie du vertrittst, sondern auch, welchen Charakter du hast“ schreibt er pointiert. Dass die „liturgische Symphonie der protestantischen Individualisten und Spezialisten“ mit einem religiösen Relativismus einhergeht, lässt sich wohl kaum bestreiten. Ist der Gottesdienst nur noch menschliches Handeln? Muss Gott halt einfach mitspielen bei all den Reformen, Kontroversen und „Verbesserungen“? Reinhard Thöle spitzt zu: „Vielleicht gibt es ja auch Gottesdienstformen, bei denen weder die Gläubigen mitspielen wollen, weil sie keine Liebe zum Gottesdienst mehr verspüren, und bei denen sogar Gott selbst kaum eine Chance hat, der zu sein, der er ist.“
Nicht nur die Anpassung der „Gottesdienstgestaltung“ an vermeintliche Erwartungen der Gemeinde und das damit verbundene Abdriften in die Unverbindlichkeit, beleuchtet Thöle kritisch, als geradezu zerstörerisch beschreibt er den weitgehenden Verlust religiöser Substanz der Gottesdienste.
Der Verlust der sonntäglichen Eucharistie – der gar nicht mehr als schädlich empfunden werde, so Thöle – ist dafür nur das gravierendste Zeichen. „Es ist wie bei einer Autoimmunerkrankung, bei der sich aus Phobie vor dem Sakralen immer neue Schübe zerstörerisch gegen sich selbst richten.“ Ein simplifizierter Predigtgottesdienst sei zum Normalprogramm geworden, „der zu besonderen Anlässen mit säkularen und neoreligiösen Elementen aufgeputzt“ werde.
Phobie vor dem Sakralen? Oder, wie Thöle es an anderer Stelle formuliert: „Angst vor der Verbindlichkeit des Glaubens, die vom Abendmahl ausgeht“? Seine Ausführungen zum „protestantischen Abendmahlsparadox“ zwingen mindestens zu einem geschärften Blick auch auf die Abendmahlspraxis in der eigenen Kirche.
Reinhard Thöles Buch ist nicht nur eine kritische Bestandsaufnahme, es ist ein Weckruf, geht es doch beim Gottesdienst nicht um eine mehr oder weniger gut gemachte Kulturveranstaltung, sondern letztlich um Leben und Tod. „Es geht um eine gefährliche Seriosität“, schreibt Thöle. „Der Mensch begegnet aus der Gefährlichkeit seines Lebens dem Dreieinigen Gott. Und die Begegnung mit ihm ist ebenfalls gefährlich. Im Gottesdienst geht es um ‚alles‘, um unser Leben und unseren Tod innerhalb seines Todes und seines Lebens.“ Und weiter: „Ist das vielleicht einer der Gründe, warum die geistlichen Berufe nicht mehr attraktiv erscheinen, weil man heute in vielen Gottesdiensten den Eindruck gewinnen kann, es geht eigentlich um nichts mehr?“
Ja, es ist ein scharfer Blick, mit dem der emeritierte Theologe die Gottesdienste analysiert. Aber womöglich ein heilsamer. Denn, so Thöle: „Gefährlich ist es, Gott im Gottesdienst zu begegnen, noch gefährlicher ist es, ihm im Gottesdienst nicht zu begegnen.“ Wem der Gottesdienst am Herzen liegt, sollte das Buch lesen.
Rezension von Doris Michel-Schmidt
Reinhard Thöle:
Geheiligt werde dein Name – Christliche Gottesdienste zwischen Anbetung und Anbiederung
Tectum Verlag 2021, 178 Seiten, 24,00 Euro
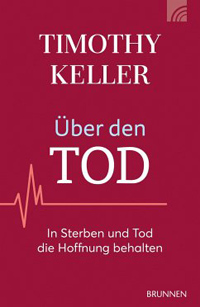 Alle Verharmlosungen und gut gemeinten Sprüche wie „Der Tod gehört zum Leben“ helfen nicht: Der Tod bleibt „die große Zäsur“, die „große Trennung“, die „große Beleidigung“, wie es der amerikanische Pastor und Autor Timothy Keller in seinem jüngsten Buch formuliert.
Alle Verharmlosungen und gut gemeinten Sprüche wie „Der Tod gehört zum Leben“ helfen nicht: Der Tod bleibt „die große Zäsur“, die „große Trennung“, die „große Beleidigung“, wie es der amerikanische Pastor und Autor Timothy Keller in seinem jüngsten Buch formuliert.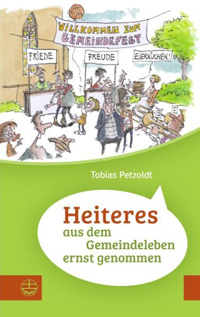 Ja, doch, das Gemeindeleben hat auch Heiteres zu bieten! Man muss bestimmte kirchliche und pastorale Gewohnheiten nur etwas zuspitzen und so liebevoll karikieren, wie das Tobias Petzoldt kann, dann ist Kirche durchaus erheiternd. Wer erkennt sich nicht in dem Familiengottesdienst, in dem man mit den Armen eine Sonne malt und einen Hut, hochspringt und aufstampft, in dem ein Meer aus Handys filmt, was die Kinder vorne spielen (was man von hinten nur erahnt). Auch das „einzigartig stille Örtchen“, das Sakristei genannt wird, kommt einem irgendwie bekannt vor. „Zwischen einer kaputten Holzkrippe vom vorletzten Krippenspiel, halb vollen Abendmahlsweinflaschen, einer Kerzenstumpensammlung und einem Kruzifix mit schiefem Heiland, dran hängen Fotos von Jubel-, goldenen und sonstigen Konfirmanden mit seltsamen Brillen und einer Mode, die gewiss einmal wiederkommen wird.“
Ja, doch, das Gemeindeleben hat auch Heiteres zu bieten! Man muss bestimmte kirchliche und pastorale Gewohnheiten nur etwas zuspitzen und so liebevoll karikieren, wie das Tobias Petzoldt kann, dann ist Kirche durchaus erheiternd. Wer erkennt sich nicht in dem Familiengottesdienst, in dem man mit den Armen eine Sonne malt und einen Hut, hochspringt und aufstampft, in dem ein Meer aus Handys filmt, was die Kinder vorne spielen (was man von hinten nur erahnt). Auch das „einzigartig stille Örtchen“, das Sakristei genannt wird, kommt einem irgendwie bekannt vor. „Zwischen einer kaputten Holzkrippe vom vorletzten Krippenspiel, halb vollen Abendmahlsweinflaschen, einer Kerzenstumpensammlung und einem Kruzifix mit schiefem Heiland, dran hängen Fotos von Jubel-, goldenen und sonstigen Konfirmanden mit seltsamen Brillen und einer Mode, die gewiss einmal wiederkommen wird.“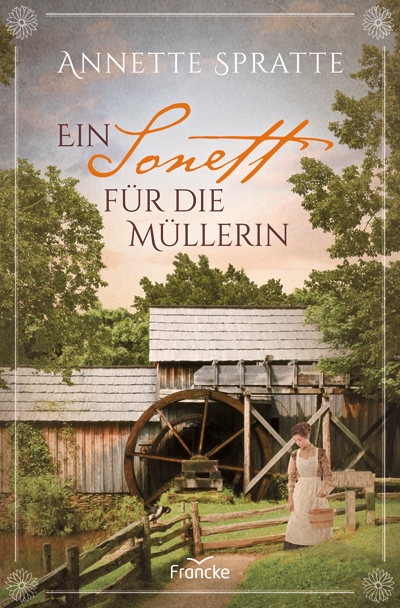 Die Autorin Annette Spratte findet ihre Geschichten in der Umgebung, in der sie lebt, im Westerwald. Und sie hat auch ihren unverwechselbaren Ton gefunden, in dem sie erzählt. Die Geschichten entwickeln sehr schnell einen Sog, der einen hineinzieht – diesmal in die Welt einer Mühle in Altenkirchen in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die 30-jährige Sophie betreibt dort mit ihrem Vater die Mühle und hofft, dass das Leben nach dem Krieg wieder besser wird und dass ihr Mann, der sich freiwillig als Söldner verdingt hatte, endlich wieder heimkommt. Als im Mühlengraben die Leiche eines Soldaten entdeckt wird, passieren seltsame Dinge auf dem Hof, und die Geschichte nimmt an Tempo und Spannung zu. Der Autorin gelingt es durch genaue Recherche nicht nur, das Mühlenhandwerk farbig und anschaulich zu schildern, sie ist auch eine Meisterin in der Figurengestaltung. Sophie, ihre Freundin Elßgen, die alte, abergläubische Magd Martha, Konrad, der Lehrling des Müllers – sie werden lebendig und gewinnen schnell die Sympathie der Leserin. Als Sophies Mann nach Hause kommt, zieht in die Mühle nicht die erhoffte Ruhe ein, im Gegenteil. Dietrich entwickelt sich zum Tyrannen, er schlägt Sophie und vergewaltigt sie. Dass es Annette Spratte gelingt, auch dieses Thema so subtil aufzunehmen, mit der damit verbundenen Erniedrigung, der Scham und dem falschen Pflichtgefühl, zeugt von großem Können und Sprachbewusstsein.
Die Autorin Annette Spratte findet ihre Geschichten in der Umgebung, in der sie lebt, im Westerwald. Und sie hat auch ihren unverwechselbaren Ton gefunden, in dem sie erzählt. Die Geschichten entwickeln sehr schnell einen Sog, der einen hineinzieht – diesmal in die Welt einer Mühle in Altenkirchen in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die 30-jährige Sophie betreibt dort mit ihrem Vater die Mühle und hofft, dass das Leben nach dem Krieg wieder besser wird und dass ihr Mann, der sich freiwillig als Söldner verdingt hatte, endlich wieder heimkommt. Als im Mühlengraben die Leiche eines Soldaten entdeckt wird, passieren seltsame Dinge auf dem Hof, und die Geschichte nimmt an Tempo und Spannung zu. Der Autorin gelingt es durch genaue Recherche nicht nur, das Mühlenhandwerk farbig und anschaulich zu schildern, sie ist auch eine Meisterin in der Figurengestaltung. Sophie, ihre Freundin Elßgen, die alte, abergläubische Magd Martha, Konrad, der Lehrling des Müllers – sie werden lebendig und gewinnen schnell die Sympathie der Leserin. Als Sophies Mann nach Hause kommt, zieht in die Mühle nicht die erhoffte Ruhe ein, im Gegenteil. Dietrich entwickelt sich zum Tyrannen, er schlägt Sophie und vergewaltigt sie. Dass es Annette Spratte gelingt, auch dieses Thema so subtil aufzunehmen, mit der damit verbundenen Erniedrigung, der Scham und dem falschen Pflichtgefühl, zeugt von großem Können und Sprachbewusstsein. Das Medaillon, das dem Buch den Titel gab, hat Rosa von ihrem Mann Itzhak zur Hochzeit bekommen. Als ihre Tochter Ania geboren wird, ist ihre Welt schon lange bedroht. 1938 ist die jüdische Familie gezwungen, ins Warschauer Ghetto zu ziehen, aber auch dort sind sie von Hunger, Zerstörung und Verfolgung bedroht. Als Itzhak sich nach Litauen durchschlägt, um seine Eltern zu suchen, spitzt sich die Situation so zu, dass Rosa ihre Tochter einer Fremden abgibt, um ihrem Kind das Leben zu retten. Sie teilt das Medaillon in zwei Teile und gibt die eine Hälfte ihrer Tochter mit.
Das Medaillon, das dem Buch den Titel gab, hat Rosa von ihrem Mann Itzhak zur Hochzeit bekommen. Als ihre Tochter Ania geboren wird, ist ihre Welt schon lange bedroht. 1938 ist die jüdische Familie gezwungen, ins Warschauer Ghetto zu ziehen, aber auch dort sind sie von Hunger, Zerstörung und Verfolgung bedroht. Als Itzhak sich nach Litauen durchschlägt, um seine Eltern zu suchen, spitzt sich die Situation so zu, dass Rosa ihre Tochter einer Fremden abgibt, um ihrem Kind das Leben zu retten. Sie teilt das Medaillon in zwei Teile und gibt die eine Hälfte ihrer Tochter mit.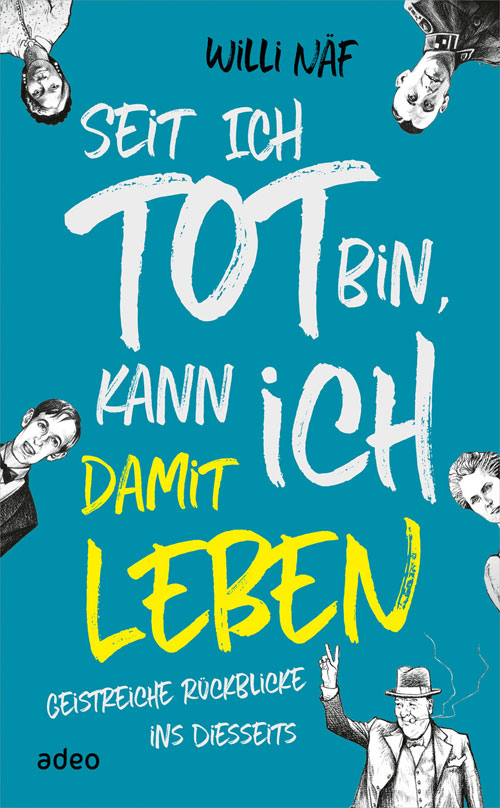 Interviews mit Verstorbenen: das ist zwar keine ganz neue Idee, die der Autor Willi Näf zur Grundlage seines Buches macht, aber so gekonnt, wie er sie umsetzt, werden sie zur außergewöhnlichen Leseerfahrung, inspirierend und unterhaltsam dazu.
Interviews mit Verstorbenen: das ist zwar keine ganz neue Idee, die der Autor Willi Näf zur Grundlage seines Buches macht, aber so gekonnt, wie er sie umsetzt, werden sie zur außergewöhnlichen Leseerfahrung, inspirierend und unterhaltsam dazu.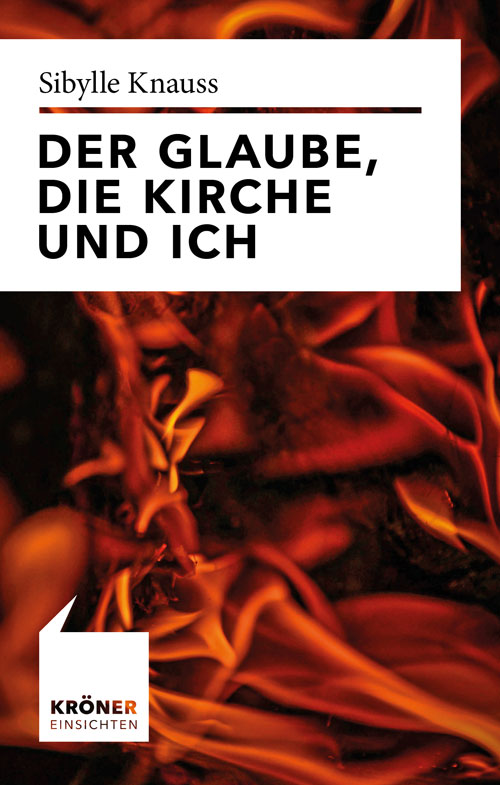 Aus der Kirche auszutreten scheint einfach: beim Meldeamt ein Formular ausfüllen und eine Gebühr zahlen – das war‘s. War‘s das? Für die Schriftstellerin Sibylle Knauss jedenfalls nicht. Ihren Austritt – sie ist damals Anfang 50 – scheint niemand in der Kirche zu bemerken oder gar zu bedauern. „So umstandslos entließ man mich aus der heiligen christlichen Kirche, wie es im Apostolischen Glaubensbekenntnis heißt? Der Kirche, in der ich mein Heil, Vergebung meiner Sünden und das ewige Leben finden sollte? Und kein Entsetzen darüber, dass ich all das von mir wies? Zumindest Bekümmerung? Oder wenigstens Bedauern. Eine Geste des Abschieds. …“
Aus der Kirche auszutreten scheint einfach: beim Meldeamt ein Formular ausfüllen und eine Gebühr zahlen – das war‘s. War‘s das? Für die Schriftstellerin Sibylle Knauss jedenfalls nicht. Ihren Austritt – sie ist damals Anfang 50 – scheint niemand in der Kirche zu bemerken oder gar zu bedauern. „So umstandslos entließ man mich aus der heiligen christlichen Kirche, wie es im Apostolischen Glaubensbekenntnis heißt? Der Kirche, in der ich mein Heil, Vergebung meiner Sünden und das ewige Leben finden sollte? Und kein Entsetzen darüber, dass ich all das von mir wies? Zumindest Bekümmerung? Oder wenigstens Bedauern. Eine Geste des Abschieds. …“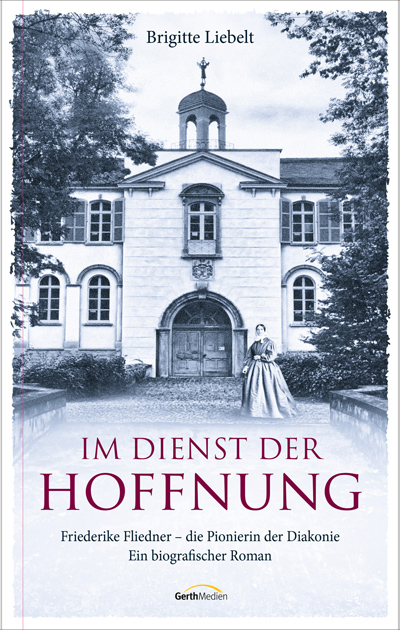 Friederike Fliedner war tatsächlich eine Frau „im Dienst der Hoffnung“, wie es der Titel des biografischen Romans zusammenfasst. Friederike Fliedner, die als ältestes von sieben Kindern nach dem Tod ihrer Mutter schon so früh Verantwortung übernehmen muss, wird nie ihre Hoffnung auf Gottes Hilfe verlieren. Auch und gerade dann nicht, wenn das Leben sie hart angreift.
Friederike Fliedner war tatsächlich eine Frau „im Dienst der Hoffnung“, wie es der Titel des biografischen Romans zusammenfasst. Friederike Fliedner, die als ältestes von sieben Kindern nach dem Tod ihrer Mutter schon so früh Verantwortung übernehmen muss, wird nie ihre Hoffnung auf Gottes Hilfe verlieren. Auch und gerade dann nicht, wenn das Leben sie hart angreift.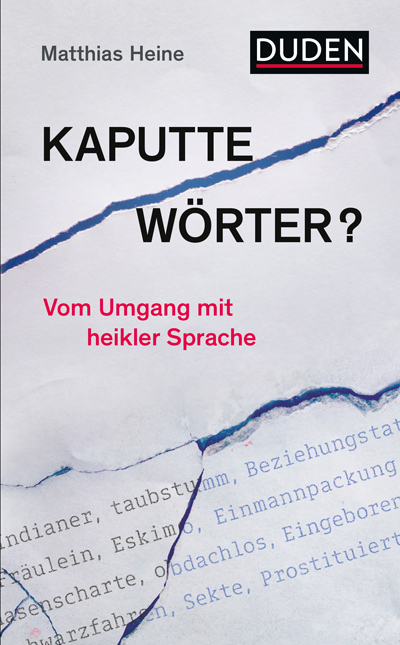 Der Journalist Matthias Heine hat sich 80 Wörter vorgenommen, die problematisch geworden sind. Sie sind „kaputt“, weil sie, so der Autor, „wenn man sie unbedacht benutzt, möglicherweise unerwünschte Kommunikationsstörungen auslösen“. Daraus kann heutzutage schnell ein Shitstorm mit schrillen Tönen werden. „Früher verhallte ein rassistisches oder sexistisches Wort meist im engen Echoraum des Stammtischs, der familiären Kaffeetafel oder der Bierzeltrede“, schreibt Heine, „heute ist der unsympathische Onkel, der allen auf den Wecker geht, weil er darauf beharrt, weiterhin Neger zu sagen, bei Facebook oder Twitter aktiv. Und ihm gegenüber sitzt nicht mehr nur eine einzige Nichte, die gern auch den Rest der Verwandtschaft darüber aufklärt, was man neuerdings – jenseits solcher unumstrittenen No-Gos – alles nicht mehr sagen soll, sondern ein Heer von Sprachwächtern.“
Der Journalist Matthias Heine hat sich 80 Wörter vorgenommen, die problematisch geworden sind. Sie sind „kaputt“, weil sie, so der Autor, „wenn man sie unbedacht benutzt, möglicherweise unerwünschte Kommunikationsstörungen auslösen“. Daraus kann heutzutage schnell ein Shitstorm mit schrillen Tönen werden. „Früher verhallte ein rassistisches oder sexistisches Wort meist im engen Echoraum des Stammtischs, der familiären Kaffeetafel oder der Bierzeltrede“, schreibt Heine, „heute ist der unsympathische Onkel, der allen auf den Wecker geht, weil er darauf beharrt, weiterhin Neger zu sagen, bei Facebook oder Twitter aktiv. Und ihm gegenüber sitzt nicht mehr nur eine einzige Nichte, die gern auch den Rest der Verwandtschaft darüber aufklärt, was man neuerdings – jenseits solcher unumstrittenen No-Gos – alles nicht mehr sagen soll, sondern ein Heer von Sprachwächtern.“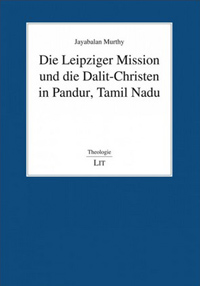 Zwei in der Missionswissenschaft diskutierte Fragen bearbeitet Pfr. Jayabalan Murthy von der Tamil Evangelical Lutheran Church, Indien, in seiner Magisterarbeit an der Georg August Universität Göttingen: einmal die in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder geäußerte Frage, inwieweit christlichen Missionsgesellschaften, in diesem Fall die Leipziger Mission, auch kolonialistische Motive bewegten, und zweitens die erst in neuerer Zeit gestellte Frage, wie diejenigen, die durch die Missionsbemühungen Christen geworden sind, die Geschichte beurteilen.
Zwei in der Missionswissenschaft diskutierte Fragen bearbeitet Pfr. Jayabalan Murthy von der Tamil Evangelical Lutheran Church, Indien, in seiner Magisterarbeit an der Georg August Universität Göttingen: einmal die in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder geäußerte Frage, inwieweit christlichen Missionsgesellschaften, in diesem Fall die Leipziger Mission, auch kolonialistische Motive bewegten, und zweitens die erst in neuerer Zeit gestellte Frage, wie diejenigen, die durch die Missionsbemühungen Christen geworden sind, die Geschichte beurteilen.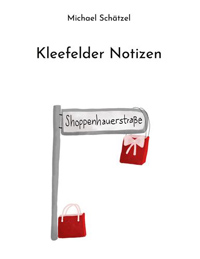 Ein Coffee Table Book für den weihnachtlichen Gabentisch
Ein Coffee Table Book für den weihnachtlichen Gabentisch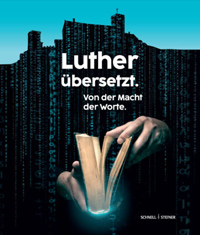 Luther übersetzt – das klingt nach Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Tatsächlich präsentiert sich die Geschichte der Bibelübersetzung im Begleitband zur Sonderausstellung „500 Jahre Neues Testament auf der Wartburg“ (4.–6. November 2022) als unabschließbarer Prozess, der bis in die Zukunft reicht. Luthers Übersetzung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache wird in diesem Band als bedeutender Meilenstein gewürdigt, weil er Gottes Wort mit der Volkssprache nicht nur erstmals theologischen Laien zugänglich gemacht, sondern auch die junge Buchdruckerkunst mit immer neuen Aufträgen versorgt hat.
Luther übersetzt – das klingt nach Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Tatsächlich präsentiert sich die Geschichte der Bibelübersetzung im Begleitband zur Sonderausstellung „500 Jahre Neues Testament auf der Wartburg“ (4.–6. November 2022) als unabschließbarer Prozess, der bis in die Zukunft reicht. Luthers Übersetzung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache wird in diesem Band als bedeutender Meilenstein gewürdigt, weil er Gottes Wort mit der Volkssprache nicht nur erstmals theologischen Laien zugänglich gemacht, sondern auch die junge Buchdruckerkunst mit immer neuen Aufträgen versorgt hat.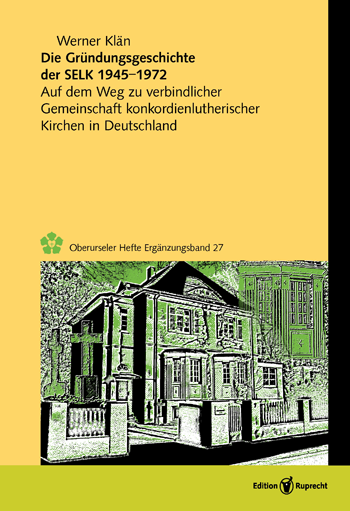 Wer schon einmal die Frage zu beantworten hatte, was die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) ausmacht und was sie von anderen Kirchen unterscheidet, wird nicht um Kirchengeschichte herumkommen. Und auch wenn heute über theologische Themen, über Strukturen und Ordnungen der Kirche gestritten wird, ist ein „Rückblick“ auf die Entstehungsgeschichte in jedem Fall unerlässlich.
Wer schon einmal die Frage zu beantworten hatte, was die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) ausmacht und was sie von anderen Kirchen unterscheidet, wird nicht um Kirchengeschichte herumkommen. Und auch wenn heute über theologische Themen, über Strukturen und Ordnungen der Kirche gestritten wird, ist ein „Rückblick“ auf die Entstehungsgeschichte in jedem Fall unerlässlich.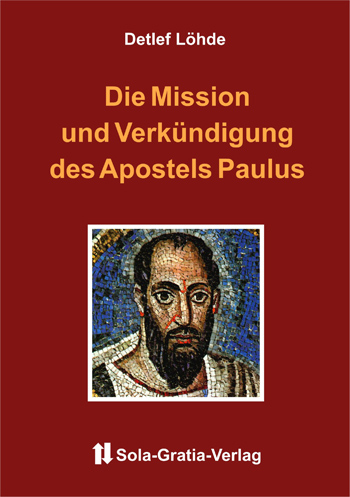 Neuen Paulusbüchern begegne ich in der Regel mit Skepsis. Es besteht immer die Gefahr, dass das uneingeschränkt gültige apostolische „Wort Gottes“ auf bloßes „Pauluswort“ reduziert wird, das heute nicht mehr so gelten, zumindest aber nicht mehr so verstanden werden könne. Nicht so bei diesem Buch. Beim ersten Anlesen schon ist es faszinierend, in Teilen sogar spannend und dazu noch in allgemeinverständlicher Sprache. Egal, ob man Angaben zu seiner Biografie sucht (Seite 152 ff.), Einleitungen zu seinen Briefen (Seite 135 ff.), Kenntnisse über die Stätten, die er im Laufe seiner Wirksamkeit berührt hat (Seite 161 ff.) oder auch das religiös-geistige Umfeld (Seite 155 ff.), immer setzt sich der Autor auch mit kritischen Auffassungen auseinander. Ein Wunder, dass es dabei vergleichsweise ein so dünnes Buch geblieben ist. Vor allem aber will der Verfasser, Pfarrdiakon in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), gemeindebezogen Dogmatik und Ethik, christliche Glaubens- und Lebensfragen, heutigen Christen verdeutlichen. Dabei scheut er sich nicht, aktuelle Probleme unserer Gesellschaft, wie Homosexualität, Antisemitismus, Frauen im Predigtamt und Ähnliches, anzugehen und im paulinischen Licht zu beleuchten. Im letzten Anhang schließlich (Seite 176), setzt er sich auch mit den neueren Theorien zum Paulusverständnis auseinander und auch das so, dass es für Laien verstehbar wird.
Neuen Paulusbüchern begegne ich in der Regel mit Skepsis. Es besteht immer die Gefahr, dass das uneingeschränkt gültige apostolische „Wort Gottes“ auf bloßes „Pauluswort“ reduziert wird, das heute nicht mehr so gelten, zumindest aber nicht mehr so verstanden werden könne. Nicht so bei diesem Buch. Beim ersten Anlesen schon ist es faszinierend, in Teilen sogar spannend und dazu noch in allgemeinverständlicher Sprache. Egal, ob man Angaben zu seiner Biografie sucht (Seite 152 ff.), Einleitungen zu seinen Briefen (Seite 135 ff.), Kenntnisse über die Stätten, die er im Laufe seiner Wirksamkeit berührt hat (Seite 161 ff.) oder auch das religiös-geistige Umfeld (Seite 155 ff.), immer setzt sich der Autor auch mit kritischen Auffassungen auseinander. Ein Wunder, dass es dabei vergleichsweise ein so dünnes Buch geblieben ist. Vor allem aber will der Verfasser, Pfarrdiakon in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), gemeindebezogen Dogmatik und Ethik, christliche Glaubens- und Lebensfragen, heutigen Christen verdeutlichen. Dabei scheut er sich nicht, aktuelle Probleme unserer Gesellschaft, wie Homosexualität, Antisemitismus, Frauen im Predigtamt und Ähnliches, anzugehen und im paulinischen Licht zu beleuchten. Im letzten Anhang schließlich (Seite 176), setzt er sich auch mit den neueren Theorien zum Paulusverständnis auseinander und auch das so, dass es für Laien verstehbar wird.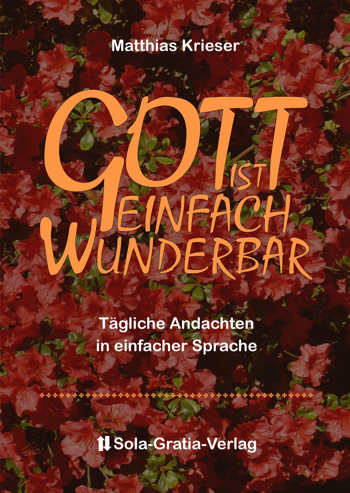 Das Angebot an Andachtsbüchern ist überschaubar; wer für die tägliche Andacht Texte lutherischer Autoren sucht, wird dieses Buch daher gern aufschlagen. Matthias Krieser, SELK-Pfarrer im Ruhestand, hat über 400 Andachtstexte verfasst, für jeden Tag des Jahres. Jede Andacht umfasst eine Seite, beginnt mit einem Bibelwort und endet mit einem Gebet.
Das Angebot an Andachtsbüchern ist überschaubar; wer für die tägliche Andacht Texte lutherischer Autoren sucht, wird dieses Buch daher gern aufschlagen. Matthias Krieser, SELK-Pfarrer im Ruhestand, hat über 400 Andachtstexte verfasst, für jeden Tag des Jahres. Jede Andacht umfasst eine Seite, beginnt mit einem Bibelwort und endet mit einem Gebet.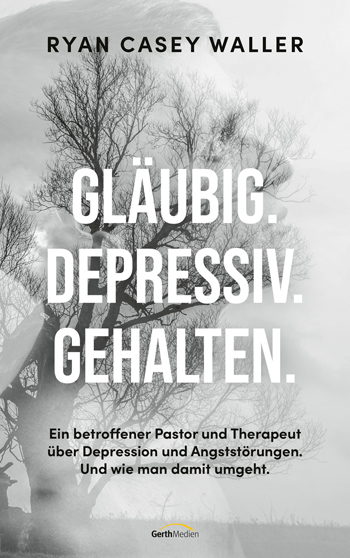 Über Depressionen zu sprechen fällt schwer, psychische Probleme verschweigt man lieber, denn sie sind oft mit Scham und Selbstvorwürfen behaftet. Wenn ein Pastor so schonungslos offen über seine Depression und Alkoholprobleme redet wie Ryan Casey Waller, kann das daher Betroffene entlasten und ermutigen. Denn seine wichtigste Botschaft lautet: „Sie sind nicht allein“.
Über Depressionen zu sprechen fällt schwer, psychische Probleme verschweigt man lieber, denn sie sind oft mit Scham und Selbstvorwürfen behaftet. Wenn ein Pastor so schonungslos offen über seine Depression und Alkoholprobleme redet wie Ryan Casey Waller, kann das daher Betroffene entlasten und ermutigen. Denn seine wichtigste Botschaft lautet: „Sie sind nicht allein“.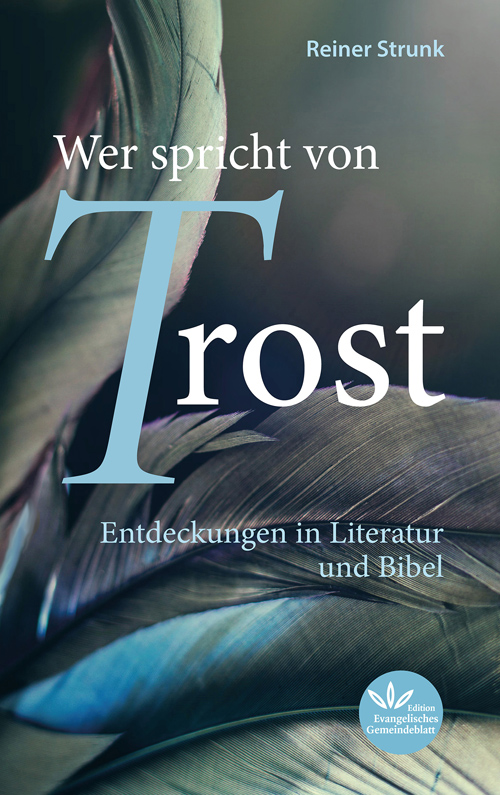 „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ So eindringlich fleht die Christenheit im Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ um Trost. So sehr brauchen wir Menschen diesen Trost, immer schon und auch und gerade in dieser Zeit. Wo bleibst du, wahrer Trost, der nicht nur vertröstet, nicht verharmlost und nicht beschwichtigt?
„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ So eindringlich fleht die Christenheit im Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ um Trost. So sehr brauchen wir Menschen diesen Trost, immer schon und auch und gerade in dieser Zeit. Wo bleibst du, wahrer Trost, der nicht nur vertröstet, nicht verharmlost und nicht beschwichtigt?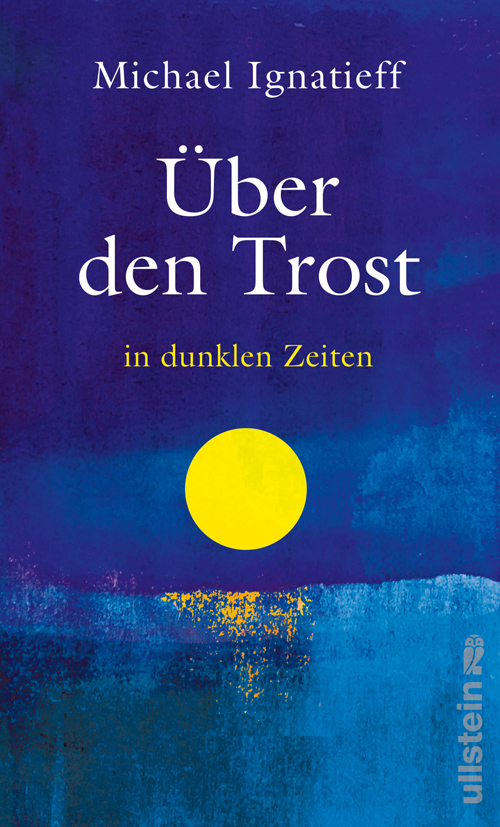 Von diesem Trost kann der Autor Michael Ignatieff in seinem Buch „Über den Trost“ nur als distanzierter Nichtgläubiger berichten. Zwar ist er selbst überrascht, dass ihn die Psalmen, insbesondere in ihren Vertonungen, trösten. Er versucht daher zu verstehen, wie „diese uralte religiöse Sprache uns so verzaubert hatte“. Immerhin bleibt da ein Staunen, eine Irritation, dass biblische Texte ihn anrühren können. Wirklich erklären kann er sich den „Zauber“ nicht. Er sucht andere „Tröstungsbemühungen“ an Beispielen von Texten und Porträts, von Cicero, Marc Aurel, Karl Marx, Albert Camus und vielen anderen.
Von diesem Trost kann der Autor Michael Ignatieff in seinem Buch „Über den Trost“ nur als distanzierter Nichtgläubiger berichten. Zwar ist er selbst überrascht, dass ihn die Psalmen, insbesondere in ihren Vertonungen, trösten. Er versucht daher zu verstehen, wie „diese uralte religiöse Sprache uns so verzaubert hatte“. Immerhin bleibt da ein Staunen, eine Irritation, dass biblische Texte ihn anrühren können. Wirklich erklären kann er sich den „Zauber“ nicht. Er sucht andere „Tröstungsbemühungen“ an Beispielen von Texten und Porträts, von Cicero, Marc Aurel, Karl Marx, Albert Camus und vielen anderen.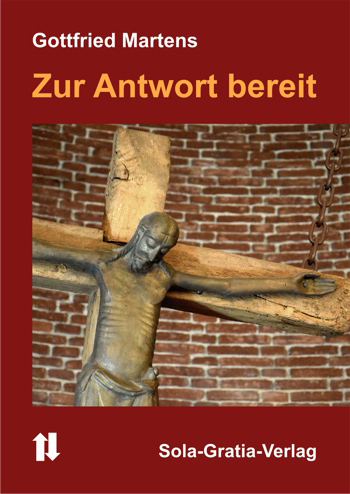 Wer kennt sie nicht, die Argumente gegen den christlichen Glauben: Die Wissenschaft habe den Glauben längst widerlegt. Jeder solle seinen eigenen Glauben haben. Man könne doch heute nicht mehr an die Bibel glauben. Und Christ sein gehe auch ohne Kirche …
Wer kennt sie nicht, die Argumente gegen den christlichen Glauben: Die Wissenschaft habe den Glauben längst widerlegt. Jeder solle seinen eigenen Glauben haben. Man könne doch heute nicht mehr an die Bibel glauben. Und Christ sein gehe auch ohne Kirche …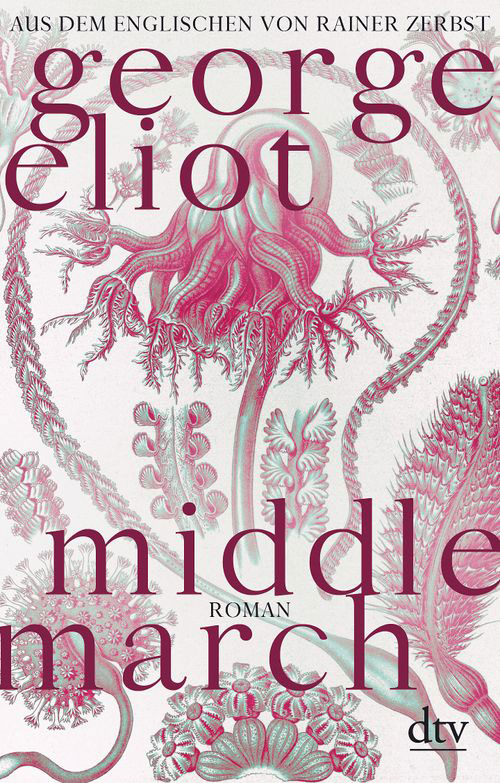 Es gibt Bücher, in die taucht man ein, sobald man zu lesen beginnt. Sie versetzen einen in ein anderes Leben, das einem selbst genügend fremd ist, um neugierig zu werden und gleichzeitig so nah, um sich selbst darin gespiegelt zu finden. Middlemarch ist so ein Buch. George Eliot, die Autorin, lebte im 19. Jahrhundert in England und hieß eigentlich Mary Ann Evans. Sie legte sich ein männliches Pseudonym zu, um ihre literarische Karriere zu befördern.
Es gibt Bücher, in die taucht man ein, sobald man zu lesen beginnt. Sie versetzen einen in ein anderes Leben, das einem selbst genügend fremd ist, um neugierig zu werden und gleichzeitig so nah, um sich selbst darin gespiegelt zu finden. Middlemarch ist so ein Buch. George Eliot, die Autorin, lebte im 19. Jahrhundert in England und hieß eigentlich Mary Ann Evans. Sie legte sich ein männliches Pseudonym zu, um ihre literarische Karriere zu befördern.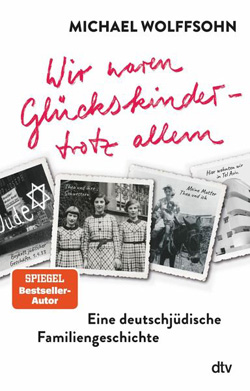 Weil sein siebenjähriger Enkel Noah „mehr über Juden und Hitler wissen“ will, schreibt Michael Wolffsohn, der Professor für Neuere Geschichte und preisgekrönte Autor sein erstes Jugendbuch. Er erzählt die Geschichte seiner Mutter Thea Saalheimer, die mit ihrer Familie vor dem Naziterror nach Tel Aviv flieht. Wie sie sich verliebt in Max Wolffsohn und mit ihm ein neues Leben aufbaut. „Im Jahr zwei nach Hitler“ wird ihr Sohn Michael geboren. 1954 kehren sie nach Deutschland zurück.
Weil sein siebenjähriger Enkel Noah „mehr über Juden und Hitler wissen“ will, schreibt Michael Wolffsohn, der Professor für Neuere Geschichte und preisgekrönte Autor sein erstes Jugendbuch. Er erzählt die Geschichte seiner Mutter Thea Saalheimer, die mit ihrer Familie vor dem Naziterror nach Tel Aviv flieht. Wie sie sich verliebt in Max Wolffsohn und mit ihm ein neues Leben aufbaut. „Im Jahr zwei nach Hitler“ wird ihr Sohn Michael geboren. 1954 kehren sie nach Deutschland zurück.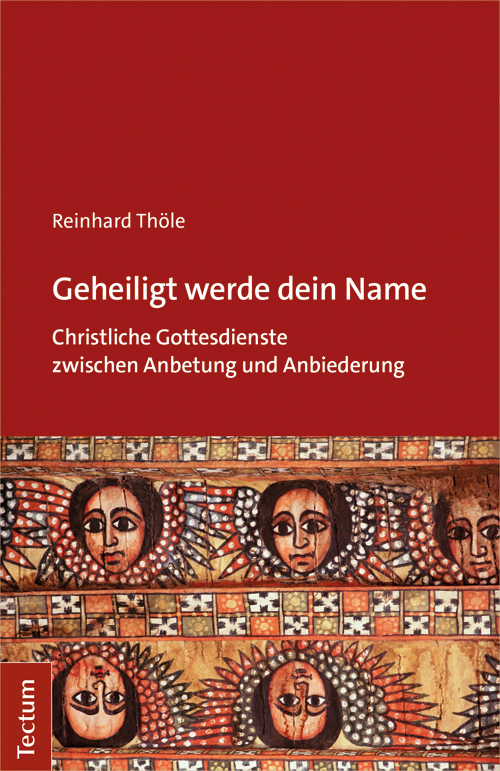 Der Umgang der Kirchen mit ihren Gottesdiensten verrät mehr über sie selbst, als ihnen lieb ist. Ist dem Gottesdienst das Heilige abhandengekommen? Reinhard Thöles Blick auf die Gottesdienstpraxis jedenfalls ist ernüchternd. Moderne experimentelle Formen sollen das eigene Milieu bei Laune halten. Da wird munter „gestaltet“ mit Versatzstücken aus einer Materialkiste, die sich speist aus tradierten Formen, aus anderen Konfessionen oder gar Religionen.
Der Umgang der Kirchen mit ihren Gottesdiensten verrät mehr über sie selbst, als ihnen lieb ist. Ist dem Gottesdienst das Heilige abhandengekommen? Reinhard Thöles Blick auf die Gottesdienstpraxis jedenfalls ist ernüchternd. Moderne experimentelle Formen sollen das eigene Milieu bei Laune halten. Da wird munter „gestaltet“ mit Versatzstücken aus einer Materialkiste, die sich speist aus tradierten Formen, aus anderen Konfessionen oder gar Religionen.